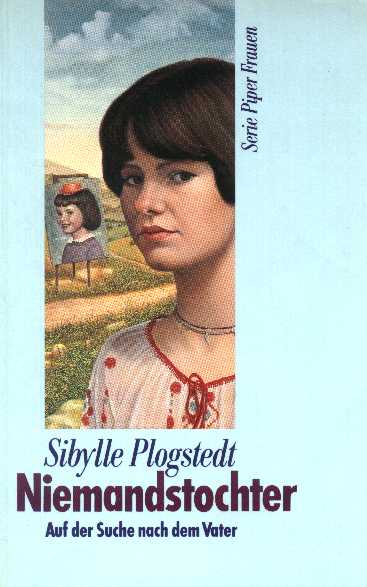
Vatersuche
Vätersuche - Suche nach dem Vater
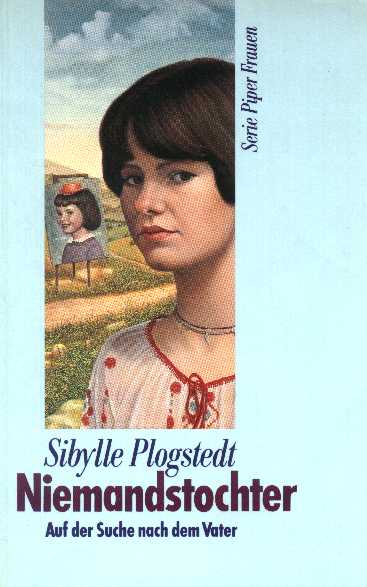
Sibylle Plogstedt "Niemandstochter - Auf der Suche nach dem Vater"
Das Bild
Mit acht Jahren fand ich sein Bild. Auf mich gerichtet, berührten seine Augen mich, hielten mich fest. Wie hypnotisiert saß ich auf dem Teppich im Wohnzimmer meiner Großmutter, das Foto vor mir auf dem Fußboden. Er strahlte so etwas Zartes aus, das mich anzog. Meine Mutter war wütend, verletzt. Ich sollte nicht heimlich in ihrem Schrank suchen. Kurz faßte sie sich, um ernst mit mir zu reden: »Das ist dein Vater. Das Foto habe ich für dich aufgehoben, du bekommst es, wenn du groß bist. Damit du einmal siehst, wie dein Vater ausgesehen hat.« Meine Mutter nahm das Bild an sich, die graubraune Pappe verschlang es, der Bindfaden schnürte ein wie ins Fleisch. »Jetzt brauchst du das ja nicht mehr«, sagte sie, »jetzt sind wir ja eine neue Familie, du, der Vati und ich.«
"Niemandstochter. Auf der Suche nach dem Vater", Sibylle Plogstedt, Piper 1991, ISBN 3-492-11330-3, z.Z. vergriffen
Beratung zum Thema Vatersuche
Väterberatung Berlin bietet professionelle Beratung bei der Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater und dem eigenen Vaterbild an. Hilfe und Unterstützung bei einer möglichen Suche nach dem eigenen Vater wird gegeben.
www.kind-vater.de/vatersuche.htm
Suche mit Happyend : „Hallo meine Große, hier ist dein Papa!“
vom
29. September 2017
Doreen Schlüter findet mit 47 Jahren über die SVZ
ihren leiblichen Vater.
von Roland Güttler
erstellt am 29.Sep.2017 |
05:00 Uhr
„Mein Name ist Doreen Schlüter und ich möchte Ihnen von ganzem
Herzen für diesen Artikel danken, denn er hat mein Leben grundlegend verändert“,
so beginnt eine längere
E-Mail an unsere Redaktion.
Vor vier Jahren
erfuhr die heute 47-Jährige den Namen ihres leiblichen Vaters, da sie für ihre
zweite Eheschließung eine neu beglaubigte Geburtsurkunde benötigte. „Bis dahin
war auf meiner Geburtsurkunde kein Vater vermerkt“, sagt die Frau aus der
Nähe von Magdeburg.
...
Schlüter schrieb ihrer Tante, wie es sich herausstellte, einen langen Brief. „Im März, zwei Tage nach meinem Geburtstag, erhielt ich einen Anruf, der mit dem Satz ,Hallo meine Große, hier ist dein Papa!‘ begann.“ Am 1. April habe sie ihren leiblichen Vater das erste Mal in Schwerin bei ihm zu Hause besucht, dessen Frau hielt das fotografisch fest. „Es war beiderseits Liebe auf den ersten Blick“, so Doreen Schlüter. Siggelkow bestätigt dies gegenüber SVZ. Die Mutter habe jeglichen Kontakt zum Kind verweigert und so gab er es irgendwann auf, habe aber all die Jahre gezahlt.
...
Film zum Thema "Vatersuche"
Sehr geehrte Damen und Herren,
Am 18. August startet unser Roadmovie CHI L'HA VISTO - WO BIST DU in den deutschen Kinos. Der Film erzählt die Geschichte eines jungen Halbitalieners, der bei seiner Mutter in Deutschland aufwuchs und sich nach nunmehr 25 Jahren auf die Suche nach seinem leiblichen Vater macht. Doch ein Gerüst aus Lügen, das er sich um seinen Vater aufgebaut hat, hält ihn davon ab, seine wahre Zugehörigkeit zu erkennen. Der Protagonist Gianni Meurer ist dabei nicht nur auf der Suche nach seinem Vater, sondern auch nach seiner eigenen Identität.
Mit Klick auf unten stehenden Link gelangen Sie zu einer Pressemeldung zum Film, dem Kinostart und der noch laufenden Crowdfunding-Kampagne auf Startnext:
http://www.openpr.de/news/555564.html
"Crowdfunding ist eine Form der Kulturförderung, bei der viele Kleinstsponsoren in einer festgelegten Zeit ein Projekt gemeinsam finanzieren. Für ihre Unterstützung erhalten die Fans verschiedene Prämien als Dankeschön, darunter ein persönliches Video des Hauptdarstellers, eine signierte DVD, Premierentickets oder sogar ein Abendessen mit der Regisseurin."
Wir würden uns freuen, wenn Sie in Ihren Online-Kanälen auf unseren Film und vor allem auch die Crowdfunding-Kampagne hinweisen könnten.
Vielen Dank,
Wolfgang Gumpelmaier
----------------------------------------------------------------
Mag.phil. Wolfgang Gumpelmaier (eU)
gumpelMEDIA - kommunikation & neue medien
Bahnhofstraße 24/3, 4070 Eferding
mobil: +43 699 1705 2749
web: www.gumpelmaier.net
mail: wolfgang@gumpelmaier.net
twitter: www.twitter.com/gumpelmaier
Peter Wawerzinek
Der Schrei nach der Mutter
Eine Provokation, ein literarisches Ereignis: Peter Wawerzineks Roman »Rabenliebe«.
Es versteht sich nicht von selbst, dass Mütter ihre Kinder lieben.
Unter Tieren ist die Brutpflege eine Regel, die Ausnahmen kennt. Bei Primaten wurde der Infantizid beobachtet, die Tötung des Nachwuchses.
Manche Naturvölker lassen Gebärende von kundigen Frauen begleiten – nicht allein, um ihnen die Niederkunft zu erleichtern, sondern auch, um sie daran zu hindern, das Neugeborene umzubringen. Die Mutterliebe, Gegenstand zahlloser Mythen und heroischer Erzählungen, ist kein Naturgesetz, sondern ein zivilisatorischer Standard, der verletzt werden kann. Die Nachricht von misshandelten, verhungerten, ermordeten Kindern ereilt uns in regelmäßigen Abständen. Wir neigen dazu, derlei als beklagenswerte Abweichung vom Normalfall zu betrachten. Doch selten ist die Perversion keineswegs.
Von einem perversen Fall, nämlich von seinem eigenen, erzählt der Schriftsteller Peter Wawerzinek in dem Roman Rabenliebe . [Teile daraus hat er kürzlich in Klagenfurt vorgetragen und dafür den Ingeborg-Bachmann-Preis erhalten] – mit Recht, denn dieses 450 Seiten starke Buch ist das zum Himmel schreiende Dokument eines verratenen, verlassenen Kindes, und es würde uns nicht erschüttern, wäre es nicht zugleich ein literarisches Kunstwerk, in dem sich das erlittene Leid zu einer gewaltigen Klage auftürmt. Wir hören das Oratorium einer Muttersuche, das Lied von der Einsamkeit, vom Barmen um Zuwendung. Keine ordentliche Chronologie lesen wir, sondern tauchen ein in die Erinnerungströme, in die Vergangenheitsbilder einer von Grund auf verstörten Seele. Die Sprache wechselt zwischen nüchternem Bericht und träumerischen Fantasien, lyrischem Singen und zorniger Anklage. Die notorischen Meldungen über Kindestötungen und Kindesmissbrauch werden eingeblendet. Geboren 1954 in Rostock, aufgewachsen in Kinderheimen der DDR, erfährt der Junge erst nach und nach seine Geschichte. Er weiß nicht, dass er eine Schwester hat. Man verschweigt ihm, dass seine Mutter noch lebt, dass sie in den Westen abgehauen ist, die beiden Kinder allein in der Wohnung zurückgelassen hat. Gerettet wurden sie, halb verhungert, von aufmerksamen Nachbarn. Am Ende, da ist er schon mehr als fünfzig, findet er die Adresse heraus. Drei Jahre lang quält er sich mit dem Entschluss. »Ich sollte die Fahrt zur Mutter nicht antreten, beschwöre ich mich. Meine Mutterfahrt ist wie eine Expedition ins Ewige Eis. Ich breche auf wie einst Scott zur Antarktis. Ich erreiche den Südpol, wenn ich den Klingelknopf zur Wohnung der Mutter drücke. Ich werde keine stolze Flagge setzen. Ich komme zu spät. Ich erreiche den Mutterpol viel zu früh. Ich werde mich zur Mutter aufmachen und dabei ums Leben kommen.«
Dennoch macht er sich auf. »Da bist du ja« ist das erste Wort der alten Frau. »Sie redet, als setzten wir eine Unterhaltung fort.« Keine Umarmung, keine Reue, nichts als Stumpfheit. »Es ist nicht genug Boden vorhanden für den beschämten Blick von mir, der sich im Boden vergraben will. Ich betrachte die Mutter und will nicht fassen, dass ich von dieser kalten Frau dort in die Welt geworfen sein soll.« Einige seiner insgesamt acht Halbgeschwister, alle im Westen geboren, lernt er kennen. Auch sie erzählen von Misshandlung und Vernachlässigung. Nach drei Stunden reist er ab. »Die Ausbeute füllt keinen Fingerhut im Vergleich zu den Gedanken, die ich mein Leben lang zu ihr gemacht habe, diesem See an Sehnsucht.« Ein Fiasko also, aber er kommt nicht ums Leben. Er rettet sich, indem er dieses Buch schreibt. Er zieht sich zurück, nimmt Abschied von der Welt da draußen. »Ich und ich. Und ich weiß mitunter nicht, ob es mich gibt, je gab, alles Einbildung von mir ist. Aus dem Spiegel hervor schaut mich niemand an. Ich führe keine Selbstgespräche mehr. Es gibt mein Spiegelbild nicht. Ich schreibe meint: Da ist also das Wesen dem Menschen fremd geworden, ein Ich, das ich nicht bin, und geht sich auch nichts an. Ich möchte mein Thema wie einen Bombengürtel tragen, mich mit ihm in die Luft jagen.« Man sieht: Wawerzinek ist ein um schrille Bilder nicht verlegener Radikalist, und zuweilen treibt er sein Lamento ins schwer Erträgliche.
Dann aber gelingen ihm Passagen von großer, trauriger Schönheit, etwa, wenn der Knabe, der erst spät das Sprechen lernt, vor lauter Einsamkeit mit den Bäumen spricht. »In der Nacht steht der Wald an meinem Bett.
Nächtliche Bäume reden auf mich ein. Wir sind vom Wind Bestäubte, wir haben wie du keinen Vater und keine Mutter nicht. Wir schütteln und wir rütteln uns dir zur Freude. Fledermäuse wohnen in unseren Armen. Wir wollen Freund dir sein.«
Und mit den Vögeln spricht das Kind. »Ich sitze mit Pudelmütze, Fäustlingen, Wintermantel am Fenster, hole mir Rotwangen, Kaltnase, Frostbeulen. Es kostet mich das Dutzend Haferflocken. Es vergehen nur einige Tage. Schon sind wir in Kontakt. Es saß ein schneeweiß Vögelein, auf einem Dornensträuchelein, din don deine, din don don, sag, willst du nicht mein Bote sein…« Und jetzt kommt das Vögelein: »Der Zaunkönig beginnt nervös auf und ab zu hüpfen. Wie soll ich es nur sagen, der Herr. Deutschland ist groß und verwinkelt. Ein Wagnis für den Herrn Sohn, nach seiner Frau Mutter Ausschau zu halten. Sie wissen so gar nix, nehme ich an, der Herr. Mein Zaunkönig schweigt, als müsse er überlegen. Sitzt lange in eingefrorener Pose, ehe er erwacht, mit neuer Kraft ein Lied zu singen beginnt: An einem Fluss, der rauschend schoss, ein armes Mädchen saß, aus ihren blauen Äuglein floss manch Tränchen in das Gras.« So bettet Wawerzinek die Lieder ein, Volkslieder, Kinderverse, die Lieder der jungen Pioniere. Sein Buch ist mehr als nur ein Leidensbericht, es ist reich an unterschiedlichen Sprachhaltungen und literarischen Bezügen, und immer spürt man sein leidenschaftliches, sprachfähiges Temperament.
Da hockt also ein Mann in der Mitte seines Lebens, betrogen um die letzte Mutterhoffnung, und Erinnerungen an die frühen Jahre suchen ihn heim. »Ich habe Angst vor den Erinnerungen und will mich vor ihnen wie vor Leibesübungen drücken. Aber es gibt für mich kein Entfliehen. Die Pfeife schrillt. Die Erinnerungen treten an, vom Hof her rufen sie laut nach mir.« Und er erinnert sich an den Schnee. Immer lag Schnee, wenn etwas Wichtiges geschah. Schnee lag, als er von einer großen schwarzen Limousine, einer russischen Tschaika, abgeholt und ins Kinderheim gebracht wurde. Hinten saß der kleine Junge, vorne schwärmte der Chauffeur von den technischen Daten der Staatskarosse.
Aber jetzt ruft sich der Erzähler zur Ordnung, fällt sich ins Wort und sagt: Dreizehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sei kein vierjähriges Waisenkind von einem Kleinkinderheim ins Vorschulkinderheim chauffiert worden, auch wenn es der Erinnerungsstolz gerne so hätte.
Also erzählt er die ganze Geschichte noch einmal, wieder liegt Schnee, aber jetzt sitzt der Junge hinter einem Ledermantelmann auf dem Motorrad. Und 33 Jahre später, als der längst Erwachsene das Heim noch einmal besucht und die Leiterin danach fragt, sagt sie ihm, nie seien Kinder mit einem Motorrad oder gar einer Tschaika gebracht worden, sondern selbstverständlich mit dem Linienbus. Der Erzähler: »Wenn ich mich erinnere, falle ich auf mich herein. Die Erinnerung ist eine Trickbetrügerin.«
So wissen wir also nicht, ob sich jedes Detail der Geschichte genau so abgespielt hat, aber dass sie wahr ist und glaubwürdig und damit eine Erkenntnis über den Einzelfall hinaus gewinnt, das bezeugt der bewegende Roman auf jeder Seite. Diese überaus deutsche Nachkriegsgeschichte erzählt ja auch vom hartnäckigen Fortleben des autoritären Charakters, von jenem Heimleiter etwa, der die Kinder dazu zwingt, den Rasen mit der Schere zu schneiden und die Kieselsteine der Einfassung weiß anzupinseln. Sie erzählt von der deutschen Teilung und von einer fast versuchten Flucht über die Grenze, als Wawerzinek Wachsoldat am Todeszaun war. Und sie gewährt einen tiefen Einblick in den spießigen Muff des Ostens während der Sechziger (der im Westen nicht viel anders war, nur komfortabler), als der Junge endlich in einer Familie landet, nach zwei gescheiterten Adoptionsversuchen. Der neue Vater ist ein zugeknöpfter Mann, die neue Mutter eine kleinkarierte Fanatikerin der Angepasstheit. Ihrer Dressur muss er sich fügen, seine Herkunft ist keiner Rede wert. »In der neuen Familie herrschte Mutterverschweigen. Mir ist ein Dach aus Schweigen über meinem Haupt gezimmert worden. Schweigen deckte mich zur Nacht zu. Schweigen erweckte mich am Morgen. Ich wusch mit dem Wasser und der Seife des Schweigens.« Allein die Großmutter begegnet ihm mit Wärme und Humor.
Fürchterlich und komisch die Schilderung einer abendlichen Orgie, als die Honoratioren der Kleinstadt zu Gast sind, fressen und saufen bis zum Erbrechen, schlüpfrige Witze erzählen und das deutsche Einheitslied Ein Prosit auf die Gemütlichkeit anstimmen, während der Junge im angrenzenden Zimmer den Schlaf sucht. Und dann die ersten Befreiungsversuche, Rockmusik, Jeans, erste Affären und kleine Revolten. Der Erzähler bemüht sich um Gerechtigkeit, schickt dem verstorbenen Adoptionsvater ein gutes Wort hinterher (nicht der Mutter) und schreibt über das Leben in den Heimen: »Ich bin nicht verhungert, musste mich nicht misshandeln und zu Tode schleifen lassen. Der Staat ist mein Kummerflügel. Das Heim ist meine Achselhöhle. Ich komme ohne Vater und Mutter aus. Das Heim ist die annehmbare Alternative zur Familie.« Dass er ohne die Mutter auskomme, ist nur eine flüchtige Illusion.
Das ganze Buch ist ein wahrhaft kindlicher, ein vergeblicher Schrei nach der Mutter, und der ist latent skandalös. Denn natürlich kann man fragen: Warum schreit er nicht nach dem Vater? Wir sind doch gerade dabei, uns in die Einsicht einzuüben, dass der Vater, um der Mutter ihren gleichberechtigten Weg in die Berufswelt zu ebnen, die Rolle der Bezugsperson genauso gut einnehmen kann, wenn er nur will. Wir setzen doch, jedenfalls im öffentlichen Diskurs, alles daran, die Mutter entbehrlich zu machen. Nein, sagt Wawerzinek, die Gebärerin, aus deren Leib das Kind kommt und wohin es nicht selten zurückwill, hat eine ungleich größere symbiotische Bedeutung als der Zeuger. Auf die Mutter kommt alles an. Und gerade deshalb, weil sich die Mutterliebe nicht von selbst versteht, ist sie unersetzlich. Diese Botschaft wird vielen missfallen. Insofern ist Peter Wawerzineks Rabenliebe nicht nur ein literarisches Ereignis, sondern auch eine Provokation.
23.08.2010
http://www.zeit.de/2010/34/L-Wawerzinek?page=all
n-online/lokales vom 08.10.2008
Eine Tochter sucht ihren Vater: Die Spur führt nach Mölln
Eine Frau sucht ihren Vater, den sie noch nie im Leben gesehen hat – und der wohnt möglicherweise in Mölln. Einige Indizien deuten jedenfalls darauf hin.
Die Frau ist Monika Lischke und wurde am 4. Juli 1971 im Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen geboren. Ihre Mutter hieß damals Brunhilde Wiezorek, geboren am 6. Februar 1945.
Frau Wiezorek, vor einiger Zeit gestorben, hat ihrer Tochter so gut wie nichts über deren Vater erzählt. Er sei längst tot – das war schon fast alles, was die kleine Monika über ihn zu hören bekam.
Doch die Aussage stimmte nicht, wie Monika Lischke heute weiß. Sie erfuhr von einer Patentante einiges, was ihre Mutter ihr nie gesagt hatte: Die Mutter hatte 1970 ein Verhältnis mit einem verheirateten, aber kinderlosen Mann. „Er war im gehobenen Dienst in der damaligen Bundeswehrverwaltungsschule im nordrhein-westfälischen Siegen tätig“, erklärt Monika Lischke. Nach ihrer Geburt sollen sich ihr leiblicher Vater und ihre Mutter noch einige Male getroffen haben, doch dann trennte sich das Paar – der Mann entschied sich für seine Ehefrau.
Kurz darauf, 1972, wurde die Bundeswehrverwaltungsschule in Mölln eröffnet. „Sehr viele Mitarbeiter der Schule in Siegen, die Karriere machen wollten, sind damals nach Mölln gewechselt oder sind dorthin versetzt worden. Es spricht vieles dafür, dass auch mein Vater darunter war“, sagt Monika Lischke.
Ihr Wunsch, nach fast vier Jahrzehnten endlich ihren Vater kennenzulernen, ist bei der Frau aus Siegen inzwischen riesengroß geworden: „Vielleicht kann man es nachempfinden, wie es ist, sein Leben lang nur einen Teil seiner Herkunft zu kennen und nicht zu wissen, wer der andere Teil ist.“ Sie wandte sich an verschiedene Dienststellen der Bundeswehr, doch dort konnte man ihr nicht weiterhelfen: „Mir ist ja noch nicht einmal der Name meines Vaters bekannt“, klagt die 37-Jährige. Sie hält es auch für denkbar, dass ihr Vater irgendwann noch einmal versucht hat, Verbindung zu ihrer Mutter aufzunehmen, doch die hatte 1973 geheiratet und den Namen ihres Mannes angenommen, so dass der Kontakt vielleicht nicht klappte.
Als „letzte Chance“ sieht sie jetzt diesen Artikel in den LN: „Ich hoffe ganz stark, dass mein Vater heute noch im Lauenburgischen wohnt und sich an Brunhilde Wiezorek aus Siegen erinnert.“ Falls das stimmt oder falls jemand einen Mann kennt, der 1972 von Siegen nach Mölln wechselte und auf den die oben beschriebenen Lebensumstände zutreffen, der möge Monika Lischke unter Telefon 01 51/12 14 34 13 anrufen.
http://www.ln-online.de/regional/2476043
07.04.2008 18:28 Uhr
Mein fremder Vater
München - Vor einer Woche entschied das Bundesverfassungsgericht, dass Eltern nur in Ausnahmefällen zum Umgang mit ihrem getrennt lebenden Kind gezwungen werden können. Doch was bedeutet es eigentlich für ein Kind, wenn der Vater sich weigert, es zu sehen?
Daniela Schumann* ist 35 Jahre und eine erfolgreiche Geschäftsfrau in München. Sie kam unehelich auf die Welt und wurde von ihrer Mutter allein aufgezogen. Ihren Vater, der viele hundert Kilometer entfernt wohnt, hat sie nie kennengelernt. Er war damals schon verheiratet und hat mit seiner Ehefrau zwei weitere Kinder, die vermutlich gar nichts von ihrer Halbschwester wissen. Für unsere Zeitung hat Daniela Schumann aufgeschrieben, wie der fehlende Vater ihr Leben beeinflusst hat:
„Was bildest du dir eigentlich ein, du unseliger Bastard, hier dauernd anzurufen?” Das war die erste emotionale Reaktion, die ich bekam, als ich mit 18 Jahren versuchte, meinen Vater telefonisch zu kontaktieren. Ich hatte zuvor bereits zweimal versucht ihn anzurufen, da war er beide Mal „mal eben mit dem Hund raus”. Ich wette, er hatte nie einen Hund. Ich habe ihn nicht angerufen, weil ich etwa Kontakt gesucht hätte oder ihn anpöbeln wollte. Ich wollte nur höflich fragen, bis wann ich mit zwei ausstehenden Unterhaltszahlungen rechnen kann.
Zugegeben, es war nicht er selbst am Telefon, es war seine Frau - aber an diesem Tag wurde mir schlagartig klar, dass ich auch die leiseste Hoffnung vergessen kann, mein Vater könnte vielleicht doch noch irgendwann Interesse an mir haben. Ein für alle Mal. Rational gesehen. Heute, 17 Jahre später, habe ich aber die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben. Heute habe ich begriffen, dass ich dieses Thema nicht abschließen kann, denn es ist Teil meines Lebens, das ich irgendwie, irgendwo unterkriegen muss.
Damals, am Telefon, war ich ohnmächtig vor Wut. Ich konnte nichts sagen, ich habe keine Luft bekommen. Ich habe mich in meinem Körper noch nie und nie wieder so unwohl gefühlt wie bei diesem Anruf - am liebsten wäre ich aus dem Fenster gesprungen, hätte lieber körperliche Schmerzen gehabt als dieses Gefühl in mir, das ich nicht kannte, und das ich auch nicht kennen wollte. Statt aus dem Fenster zu springen, habe ich alles, was nicht niet- und nagelfest war, an die Wand geschmissen. Meine Oma stand weinend neben mir, wollte mich halten, ich habe sie angebrüllt, weggestoßen, mich eingesperrt. Und ich habe gewartet, dass er anruft. Dass er sagt: „Es tut mir leid, dass sie dich so behandelt hat, das wollte ich nicht, das tut mir weh. Entschuldige bitte.” Da kam aber kein Anruf - und das hat am meisten weh getan.
Vaterlose Kinder sind wahrlich kein Phänomen mehr - aber wenig weiß man darüber, wie es ihnen geht. Das liegt sicher auch daran, dass man so schwer über diese Situtation sprechen kann. Wie soll man auch erklären, wie schmerzhaft es ist, etwas zu vermissen, das man gar nicht kennt?
Als es in meinem Freundeskreis die ersten Scheidungskinder gab, habe ich immer wieder einen Kommentar gehört: „Da geht‘s dir besser, du hast ihn ja wenigstens gar nicht gekannt, du kannst wenigstens nichts vermissen. Das tut ja nicht so weh.” „Stimmt”, hab ich dann immer gesagt. Anfangs dachte ich noch, dass ich das auch so meine - weil ich es nicht benennen konnte. Dabei hatte ich bis dahin schon verschiedene Stadien durchlaufen: Als Kind habe ich gar nicht kapiert, dass es nicht normal ist, keinen Vater zu haben. Das war zwar irgendwie komisch, aber nicht so schlimm. In der Schule habe ich dann begriffen, dass eigentlich alle einen Vater haben - selbst, wenn er nur am Wochenende kommt. Väter machen einfach andere Sachen mit ihren Kindern als Mütter, das geht schon beim geplatzen Fahrradschlauch los: Bei den anderen Kindern hat das Papa repariert - ich war Stammgast in der Fahrradwerkstatt. Und da habe ich gemerkt, dass mir da irgendwie was fehlt. Auch emotional. Die anderen Kinder redeten über ihre Väter immer mit mehr Stolz, die sind die Helden. Und da habe ich dann ein schlechtes Gewissen bekommen - weil meine Mutter immer für mich da war, weil sie alles getan hat. Und: Weil sie nie schlecht über ihn geredet hat.
Ich bin nicht damit aufgewachsen, dass „er” der Feind ist oder ein schlechter Mensch. „Man steckt nicht drin”, hat sie immer gesagt, oder, „Du weißt nicht, warum er sich nicht meldet”, wenn wir mal drüber gesprochen haben, und das war nicht oft. Und genau dafür habe ich ihn dann irgendwann gehasst. Weil ich irgendwann gemerkt habe, was für eine Last das für meine Mutter ist, dass sie fast daran kaputtgeht, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht und ich nichts vermisse. Sie wollte unauffällig meinen Schmerz für mich mittragen und mir dieses Gefühl „Der will dich nicht” ersparen. Meiner Mutter hat er mehr weh getan als mir, ihr hat er zweimal das Herz gebrochen: einmal als Frau und einmal als Mutter. Für sie wäre es sicher leichter gewesen sich als gute Mutter zu fühlen, wenn sie einen Vater dazu gehabt hätte. Und das ist neben seinem Fehlen der zweite Schatten, den ich nicht abwerfen kann, und der mir weh tut.
Es ist unglaublich, wie präsent jemand sein kann, der nie da war. Nach der Hassphase kam das absolute Negieren. Alle haben mich immer gefragt: „Willst du den nicht mal kennenlernen?” Ich habe zuerst immer „Nein” gesagt. Irgendwann habe ich die Frage nicht mehr beantwortet. Ich habe ein Statement abgegeben: „Ich hasse ihn nicht mehr. Denn Hass ist ein Gefühl, und Gefühle will ich an den nicht verschwenden.” Daran wirklich zu glauben, mir selbst zu glauben, hat gedauert. Das ging eine ganze Zeit lang gut: Ich habe Abitur gemacht, ich habe mich auf meine Zukunft konzentriert, dann habe ich für meine Zukunft gearbeitet.
Im Alter von 19 bis vielleicht 28 Jahren hat mein fehlender Vater keine große Rolle gespielt. Als sich die ersten Erfolge eingestellt haben, hätte ich ihm dann doch gern gezeigt, wer ich bin, was ich heute mache. Ich wollte ihm zeigen, dass aus mir was geworden ist, auch ohne ihn. Gerade ohne ihn. Ich wollte ihm zeigen, dass mir etwas Besseres gar nicht hätte passieren können als seine Abwesenheit.
Weil ich glaube, so wäre ich nie geworden, wenn er mir nicht so gefehlt hätte. Purer Trotz, immer noch. Und wieder habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich an meine Mutter denke. Ist es nicht vielmehr sie, die mich dazu gemacht hat?
Irgendwann hab ich angefangen, ihn anzurufen. So ein Mal im Jahr. Ich wollte ihn ärgern. Es waren immer Feiertage oder Wochenenden, an denen ich mich nicht gut gefühlt habe. Dann wollte ich sein trautes Familienleben stören. Er hat immer geschwiegen. Solange, bis ich aufgelegt habe. Einmal habe ich ihn im Internet gesucht und ein Foto gefunden. Alle haben immer gesagt, ich sehe aus wie er. Was ich aber gesehen habe, war das Foto eines alten, ausgemergelten Mannes. Meinen Vater habe ich mir nie als alten Mann vorgestellt. Trotzdem hat es mich befriedigt: Er sah nicht glücklich aus. Das ist das Beste, was ich über meinen Vater sagen kann. Und gleichzeitig denke ich, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich ihm nicht verzeihen kann.
Ich warte immer noch darauf, dass er anruft, mich endlich kennenlernen will. Dass er sagt: „Ich habe einen Riesenfehler gemacht, der mein ganzes Leben überschattet hat. Weißt du, ich konnte nie ein glücklicher Mensch werden, wegen dir, weil ich nicht gesehen habe, wie du gewachsen bist, wie du gereift bist. Ich weiß ja noch nicht mal, wie du aussiehst. Es gab keinen Tag, an dem ich mich nicht geschämt habe. Das sollst du wissen. Und jetzt, jetzt würde ich dich...”
Und in diesem Moment würde ich auflegen, kommentarlos. Vielleicht könnte ich mir auch ein leises, kaltes „Zu spät” nicht verkneifen.
* Name von der Redaktion geändert
http://www.merkur-online.de/vermischtes/blickpkt/art9400,908420
HERKUNFT / Die Suche nach den Wurzeln
Versöhnung mit dem eigenen Schicksal
Für adoptierte Kinder ist es schwer genug zu verarbeiten, dass ihre Eltern sie nicht wollten. Umso wichtiger, sagen Experten, dass ihre Herkunft für sie kein Geheimnis bleibt.
ANTJE BERG
Anita-Verena Brandsch war zwölf Jahre alt, als sie von einem Nachbarkind erfuhr, was in der ganzen Straße gemunkelt wurde: Sie war ein adoptiertes Kind. Außer sich rannte sie nach Hause, wo die Adoptiveltern nicht umhin konnten, ihr die Wahrheit zu sagen: "Ich spüre noch heute, wie ich in dieses tiefe, schwarze Loch falle", sagt die 52-Jährige. Das Schlimmste war, "dass die Menschen, die ich so liebte und die mich auch liebten, mich derart getäuscht hatten".
Erst mit 27 Jahren, als sie ihr drittes Kind bekam, entschloss sich die Stuttgarterin, nach ihren leiblichen Eltern zu suchen. Sie fand erst die Mutter, die in den 50er Jahren das uneheliche Kind auf Druck der Verwandtschaft zur Adoption freigegeben hatte, später spürte sie auch den Vater auf. Sie führte klärende Gespräche, schrieb sich nächtelang alles von der Seele. "Auch wenn ich nicht auf alle Fragen eine Antwort bekommen habe, ist es mir doch gelungen, mich mit meiner eigenen Geschichte zu versöhnen", sagt sie. "Heute tut es nicht mehr weh."
Adoptierte Kinder müssen ihre Wurzeln kennen. "Denn für sie ist es schwer genug zu verarbeiten, dass sie von ihren leiblichen Eltern nicht gewollt waren", sagt die Adoptionsforscherin Christine Swientek. Sie berichtet von Adoptierten, die 15 Jahre lang nach ihren leiblichen Eltern suchten, bis sie fündig wurden - "eine qualvolle Zeit am seelischen Abgrund".
Aus diesem Grund plädiert Swientek für die so genannte halboffene Adoption. Dabei wird der Kontakt zwischen leiblichen Eltern und Kind mit Briefen und Fotos über Dritte wie etwa das Jugendamt aufrechterhalten. Das Verfassungsgericht hat das Recht auf Kenntnis der Abstammung bereits 1988 betont.
Niemand weiß, wie viele Erwachsene heute nach ihrer Herkunft forschen. Die Behörden sind inzwischen verpflichtet, Verfahrensakten statt bisher 40 nun 60 Jahre aufzuheben. Adoptierte Kinder haben ab dem 16. Lebensjahr das Recht auf Einsicht in den Geburtseintrag des Standesamtes, aus dem sich zumindest die Daten der leiblichen Mutter ergeben.
Erscheinungsdatum: Freitag 21.12.2007
Anonyme Samenspende
Röhrchen mit Spendersperma.
Suche nach dem Vater
von Friedrich Kurz und Rita Stingl
Deutsche Reproduktionsmediziner haben mit Hilfe von anonymen Samenspenden seit den 70er- Jahren bisher rund 100.000 Kinder gezeugt. Doch viele Spenderakten sind inzwischen vernichtet. [mehr]
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/1/0,1872,1001633,00.html
Suche nach dem Vater
Die Kinder aus der Samenbank
von Friedrich Kurz und Rita Stingl
Deutsche Reproduktionsmediziner haben mit Hilfe von anonymen Samenspenden seit den 70er Jahren bisher rund 100.000 Kinder gezeugt. Doch viele Spenderakten sind inzwischen vernichtet, obwohl die Kinder ein Recht haben, zumindest die Grunddaten ihres "genetischen Vater" zu erfahren.
* Sendung am 04.12.2007
Sonja ist 26 Jahre alt, als sie beim Abendessen von ihrer Mutter die Wahrheit über ihre Herkunft erfährt. Der Mann, den sie immer für ihren Vater hielt, ist nicht ihr leiblicher Vater. Sie ist das Ergebnis einer anonymen Samenspende. Für ihre Eltern war es damals die einzige Möglichkeit, ein Kind zu bekommen, denn ihr Vater war wegen einer Krankheit zeugungsunfähig. Sonjas Mutter ließ sich in einer repromedizinischen Praxis fremden Spendersamen in die Gebärmutter injizieren - so bekam sie Sonja.
Kein Vertrauen mehr
Für die Tochter ist die Nachricht ein Schock: Ihre Eltern hätten jahrzehntelang ihre Abstammung verheimlicht; damit habe sie quasi einen Teil ihrer Familie verloren. Jetzt habe sie kein Vertrauen mehr zu ihren Eltern, sagt Sonja, dabei sei ihr dieses Vertrauen besonders wichtig gewesen. Mit ihren Eltern hat sie seither kaum mehr gesprochen.
Sonja ist eines von den rund 100.000 "DI-Kindern" (Donogene Insemination) in Deutschland, von denen viele nichts über ihre Herkunft wissen. Entweder, weil die Eltern nie darüber gesprochen haben, oder auch, weil die Samenspender-Akten nicht mehr existieren. Manche Kinder entdecken erst beim Blutspenden aufgrund der unterschiedlichen Blutgruppe, dass sie einen anderen Vater haben, andere erfahren es während eines elterlichen Scheidungsstreits.
Thomas Katzorke.
Katzorke: "Die Vaterschaft ist ein soziales Phänomen."
Recht auf Kenntnis der Abstammung
Mittlerweile bieten rund 40 Arzt-Praxen die donogene Insemination in Deutschland an - das Geschäft der Samenbanken boomt. Als einer der ersten hat Prof. Dr. Thomas Katzorke seine private Reproduktions-Klinik gegründet. Er führte die Spendersamen-Methode in den 70er Jahren an der Uni-Klinik Essen ein, damals noch als wissenschaftlicher Assistenzarzt. Gleichzeitig baute der Pionier Katzorke eine Samenbank auf, in der tiefgefrorene Spermien von mehreren tausend Spendern lagern. Allein sein Institut hat zehntausenden Frauen zu Kindern verholfen. Das sei eine mittlere Kleinstadt, meint er stolz.
Wenn diese Kinder volljährig werden, dann haben sie inzwischen das Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung. So hat das Bundesverfassungsgericht 1989 geurteilt und damit auch die Rechte der Kinder gestärkt. Die können versuchen, Kontakt zu ihrem genetischen Vater aufnehmen. Der jedoch kann den Kontakt ablehnen.
Sonja blickt aufs Wasser.
Sonja will wissen, wer ihr genetischer Vater ist.
"Eine Vaterrolle, die es nie gab"
Um den Zugang der Kinder auf die Spenderakten besser zu regeln, planen die Repromediziner die Gründung einer zentralen Daten-Sammelstelle. Doch einige Ärzte, wie Prof. Katzorke, wollen die älteren Spender-Daten ohne Gerichtsurteil nicht so einfach herausgeben. Damals habe es noch keine Rechtsgrundlage für eine langjährige Speicherung gegeben. Die DI-Kinder stellten sich das Zugangsrecht zu idealistisch vor, so Katzorke. Dieser Samenspender, der damals "nur für fünf Minuten, teilweise nur sekundenlang als Erzeuger aufgetreten" sei, solle nun plötzlich in die Vaterrolle schlüpfen, die es so nie gegeben habe.
Doch DI-Kinder wie Sonja wollen Antworten auf ihre Fragen: Wer ist mein Vater? Habe ich Halbgeschwister? Vergeblich bat sie Prof. Katzorke um die Daten ihres Samenspenders, ihres genetischen Vaters. Die Uniklinik hat die alten Akten nach zehn Jahren vernichtet - so war es damals noch Vorschrift. Die Politik hat sich um die vielen Kinder, die damals "donogen" gezeugt worden, nie gekümmert.
Identität verloren
Sonja versucht jetzt, die Essener Uni-Klinik auf Schadenersatz zu verklagen. Eine Samenspende sei mit einer Blutspende nicht zu vergleichen. Hier würden Menschen gezeugt, mit eigener Identität, mit eigenen Rechten und Bedürfnissen, sagt sie. Sonja und viele andere sind die Leidtragenden der Aktenvernichtung. Zwar wurde die Aufbewahrungszeit der Akten kürzlich auf 30 Jahre verlängert. Doch da war es schon viel zu spät. Zehntausende von DI-Kindern der Anfangsjahre haben einen Teil ihrer genetischen Identität bereits verloren.
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/30/0,1872,7130270,00.html
ZDFinfokanal, Freitag, 28.09.2007, Magazin/Mensch/Gesundheit 21:00 - 21:30 Uhr
Wer ist mein Vater?
Töchter auf der Suche
Behörden und Konsulate hat Christine K. aus Niedersachsen eingeschaltet, viel Zeit, Energie und Geld geopfert, um endlich ihren wirklichen Vater kennen zu lernen.
'Es ist wie ein Trieb, gegen den ich nicht ankomme und der eine dauernde innere Unruhe in mir erzeugt', beschreibt die 40jährige allein erziehende Mutter ihren Gemütszustand. Der drängende Wunsch bestimmte ihr Leben immer mehr, als sich die Mutter, unter schweren Depressionen leidend, das Leben nahm. Da war Christine 14, und es begann die eigentliche Suche. Der Film begleitete sie sechs Monate lang dabei, bis Christine K. endlich fündig wurde: 'Mit butterweichen Knien und am ganzen Leib zitternd' stand sie dann, nach jahrzehntelanger Suche, vor der Tür des Hauses, in dem ihr Vater arbeitete. Tausende Kilometer entfernt von zu Hause - an der galizischen Küste. Doch was sie dann erlebte, war eine einzige, neuerliche Kränkung. Die Suche nach dem unbekannten Vater bestimmt das Leben vieler Menschen. Es ist anders, als wenn ein geliebter Vater stirbt. Grundfragen bleiben unbeantwortet: Hat er mich überhaupt gewollt? Würde er mich akzeptieren, wäre ich 'sein' Kind? Würde er mich lieben? Besonders die nie erklärte Abwesenheit des gegengeschlechtlichen Elternteils kann Kinder in bestimmten Wachstumsperioden schwer belasten. Jeder Mensch möchte ein Kind der Liebe sein und nicht eine Art Betriebsunfall. Verständlich, dass die Suche nach dem großen Unbekannten zum Zwang werden kann. Persönlichkeiten geraten aus dem Gleichgewicht, Identitäten entzieht es den Boden. In Christines Fall hat es sogar zu zeitweiligen psychotischen Zuständen geführt.
Thomas Rilk begleitete Arabella Kiesbauer nach Ghana
"Am Schauplatz" am 21. September 2007: Vater gesucht
19.09.2007 08:57:15 - Thomas Rilks "Am Schauplatz"-Reportage "Vater gesucht" erzählt am Freitag, dem 21. September 2007, um 21.15 Uhr in ORF 2 eine ungewöhnliche Familiengeschichte. Arabellas Mutter ist Österreicherin, der Vater war Afrikaner. Doch weil sich die Eltern getrennt haben, als sie noch ein Kleinkind war, haben Tochter und Vater einander nie wirklich kennengelernt. Fast vierzig Jahre später reist Arabella Kiesbauer - inzwischen ein Fernsehstar geworden - zum ersten Mal nach Ghana, um ihre Geschwister kennenzulernen und mehr über den verstorbenen Vater zu erfahren. Das Gefühl, anders zu sein als ihre Umgebung, hat ihre Kindheit geprägt. Um diesen unbekannten Teil ihres Selbst besser zu verstehen, begibt sie sich in die Welt ihrer Vorfahren.
(live-PR.com) -
Begleitet wird Arabella von ihrer Mutter. Als junge Frau hat Hannelore ihren Mann verlassen und Afrika den Rücken gekehrt. Jetzt kommt sie zum ersten Mal zurück, um sich gemeinsam mit der Tochter ihrer Vergangenheit zu stellen.
Die Reportage entstand als Koproduktion des ORF und der Rilk Film, gefördert vom Fernsehfond Austria, und ist am Mittwoch, dem 26. September, um 18.00 Uhr auch in 3sat zu sehen. 3sat zeigt darüber hinaus voraussichtlich im Dezember 2007 eine 45-minütige Dokumentation über Arabella Kiesbauers Reise nach Ghana. Über ihr neues Buch "Mein afrikanisches Herz" und ihre Reise nach Afrika spricht Arabella Kiesbauer auch mit Reinhard Jesionek in "Sommerzeit" am Donnerstag, dem 20. September 2007, um 17.40 Uhr in ORF 2.
Rückfragehinweis:
ORF-Pressestelle
Karin Wögerer
(01) 87878 - DW 12913
presse.ORF.at
Quelle: http://www.live-pr.com/am-schauplatz-am-21-september-vater-r1048151749.htm
Wer ist mein Vater? Die verzweifelte Suche einer jungen Frau nach ihren Wurzeln
Romana Buchner glaubte lange Zeit, ihren Vater zu kennen. Die 25-Jährige wuchs in Zell am See in behüteten Familienverhältnissen auf. Der mittlerweile geschiedene Ehemann ihrer Mutter war ihr stets ein liebevoller und aufmerksamer Papa.
Trotzdem hatte Romana immer das Gefühl, in der eigenen Familie fremd zu sein. "Ich habe gespürt, dass ich anders bin - sowohl im Aussehen als auch im Charakter. Da gab es immer eine Seite an mir, die nicht in diese Familie gepasst hat."
Im Alter von 18 Jahren erfuhr Romana dann in einem Streit mit der Mutter die ganze Wahrheit über ihre Abstammung. Sie ist unter einem "falschen" Vater aufgewachsen. Romanas leiblicher Vater lebt in Deutschland und hat dort eine Familie. Romana selbst sollte dieses Familiengeheimnis eigentlich nie erfahren.
Romanas Leben hat sich seither schlagartig geändert. "Von einem Moment auf den anderen hatte ich keine richtige Familie mehr. Schwester ist plötzlich Halbschwester, Papa ist nicht mehr Papa." Nun will Romana über "help tv" ihren leiblichen Vater finden. "Ich habe ein Recht darauf, meine Wurzeln zu kennen. Ich will endlich verstehen, wer ich wirklich bin."
Wie sehr leiden Kinder darunter, ihre leiblichen Eltern nicht zu kennen? Welche Folgen hat das für Selbstwertgefühl und Identität? Und welche Rolle spielt der abwesende Elternteil in ihrem Leben? Darüber sprechen Romana Buchner und die Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger bei Barbara Stöckl im Studio. Ein Bericht von Silke Tabernik
Barbara Stöckl präsentiert "help tv" am Mittwoch, dem 5. September 2007, um 20.15 Uhr in ORF 2 live aus Wien
http://tv.orf.at/program/orf2/20070905/418504301/
http://www.live-pr.com/help-tv-am-5-september-252-ber-r28059.htm
Akt. 02.09.07; 22:30 Pub. 02.09.07; 22:30
Nachwuchsrapper Tumen sucht Vater mit einem Song
Der Zürcher Rapper Tumen wurde als kleines Kind von seinem Vater verlassen. Jetzt ruft er ihn mit einem Rap-Song auf, sich bei ihm zu melden.
Rapper Tumen ruft seinen Vater mit einem Lied dazu auf, sich bei ihm zu melden. (Bild: lüs)
Der 15-jährige Zürcher Nachwuchs-Rapper Tanju Solinas aka Tumen wurde mit seiner Hymne zum ersten FCZ-Meistertitel nach 25 Jahren bekannt. Jetzt hat er einen sehr persönlichen Song geschrieben. Im Track «True Story» wendet er sich an seinen Vater: «Ich weiss nicht, ob du noch lebst und wo du lebst», rappt er.
Tumen war sechs oder sieben Jahre alt, als sein Vater ihn und seine Mutter verliess: «Er sagte mir am Telefon, er sei nun weg.» Zweimal ist er ihm noch zufällig begegnet. Vor drei Jahren lief er ihm in einem Schuhladen über den Weg: «Dabei hielt er einen Jungen an der Hand, der mich an mich selber erinnerte, wie ich war, als er wegging», so Tumen zu 20 Minuten. Ein paar Monate später kam es zur bisher letzten Zufallsbegegnung: «Er drückte mir etwas Geld in die Hand und sagte, er müsse weiter.»
Tumen leidet unter der Abwesenheit seinen Vaters: «Immer wieder sagte ich, ich sei darüber hinweg, und jedes Mal war es gelogen», singt er. Seinem Vater gegenüber fühle er Enttäuschung und Wut, sagt er, aber: «Ich würde ihm noch eine Chance geben.»
Marco Lüssi
http://www.20min.ch/news/zuerich/story/11150597
Song rechts unter Audio anzuhören, leider in ‚Schwiezerdütsch’
Sharon holt gefallenen Vater nach Hause
26. Mai 2007
KRIEGSSCHICKSAL
Die Heimkehr des Leutnants Estill
In den letzten Kriegstagen 1945 wurde der Pilot Shannon Estill über Deutschland abgeschossen. 60 Jahre später fanden Spezialisten der US-Armee seine Leiche und überführten sie in die USA. Die jahrzehntelange Suche einer Tochter nach ihrem Vater hatte plötzlich ein Ende.
Hamburg - Freitag, der 13. April 1945, ist für die alliierten Truppen in Europa ein Tag zwischen Triumph und Trauer: Wien wird von sowjetischen Verbänden eingenommen, 60 Kilometer vor Berlin bereitet sich die Rote Armee darauf vor, die Hauptstadt des Feindes zu stürmen, und der deutsche Ruhrkessel wird von Briten und Amerikanern immer weiter zusammengedrückt. Am Vortag jedoch ist der US-Präsident Franklin D. Roosevelt gestorben - viele GIs, die an den Fronten in Asien und Europa stehen, sind bestürzt. Doch sie kämpfen weiter.
Lieutenant Shannon Estill rollt am späten Vormittag des 13. April auf einem Feldflugplatz bei Euskirchen zu seiner Startposition. Gemeinsam mit seinen Kameraden des 428. Fighter Squadron soll er Ziele in Sachsen angreifen. Shannon Estill ist 22 Jahre alt, frisch verheiratet, stammt aus Cedar Rapids in Iowa und gilt als erfahrener Pilot. "Shannon und ich sind oft zusammen geflogen. Er war ein netter Kerl. Wie die meisten von uns hat auch er versucht, das Beste aus der Situation zu machen", erinnert sich Estills ehemaliger Kamerad Roy Easterwood.
Seit Herbst 1944 ist Estill in Europa, 33 Feindflüge hat er hinter sich, dieser soll der letzte werden. Denn er ist vor wenigen Wochen Vater eines Mädchens geworden. Der Heimaturlaub ist schon genehmigt. Um 12.58 Uhr heben die elf P-38 "Lightnings" ab. Ihr Einsatz soll rund vier Stunden dauern.
Das Dorf Elsnig liegt in einer verschlafenen Ecke des Freistaates Sachsen, nahe Torgau. Im idyllischen Dorfalltag fallen die Männer und Frauen deshalb umso mehr auf, die im Frühjahr 2005 plötzlich mit allerlei Gerät einen Acker umzugraben beginnen und das Erdreich durchsieben. Die kleine Gruppe ist eines der 18 Teams, die weltweit für das "Joint POW/MIA Account Command" (JPAC) der US-Armee nach den Überresten der knapp 80.000 vermissten Soldaten fahnden.
Eine schlanke Frau mit rötlichen Haaren verfolgt die Arbeiten besonders angespannt. Sharon Taylor sucht ihren Vater. Und es scheint, als wäre sie ihm jetzt - nach fast drei Jahrzehnten unermüdlicher Suche - endlich so nahegekommen wie niemals zuvor. Sie sagt: "Dieser Acker ist für mich ein heiliger Ort. Ich kann die Präsenz meines Vaters fast schon spüren." Sharon Taylor, Professorin an der Saint Martins-University in Seattle, hat sich nie damit abgefunden, nur eine weitere Kriegswaise zu sein. Der abwesende Vater hat ihre Kindheit geprägt.
http://www.spiegel.de/panorama/zeitgeschichte/0,1518,485069,00.html
26. Mai 2007
KRIEGSSCHICKSAL
Die Heimkehr des Leutnants Estill
2. Teil: "Nur eines gibt es im Überfluss: Angst"
Shannon Estill und seine Frau Mary Kathryn hatten geheiratet, kurz bevor der Bräutigam nach Europa abkommandiert wurde. Dann schrieben sich die Liebenden unermüdlich Briefe. "Ich bin so froh, dass Ihr in den Staaten seid und nicht in Europa", notierte der junge Offizier. "Hier fehlt es an allem. Nur eines gibt es im Überfluss: Angst."
Mary hingegen berichtete Alltägliches aus dem friedlichen Amerika: "Habe ich Dir von unserem neuen Kinderwagen erzählt? Er ist wirklich schön, die Räder und Griffe sind aus Metall. Ich kann es kaum erwarten, dass du wieder nach Hause kommst." Und sie setzte die Korrespondenz auch noch fort, nachdem ein Emissär der US-Armee ihr am 30. April 1945 mitgeteilt hatte, dass Shannon Estill über Deutschland vermisst werde und wahrscheinlich gefallen sei.
"Sie hat nicht aufgehört, ihm zu schreiben", sagt Sharon Taylor, "denn Hoffnung war alles, was sie hatte. Sie konnte nicht glauben, dass es vorbei war." Sharon bekommt zu ihrem 21. Geburtstag ein besonderes Geschenk: 450 Briefe ihre Vaters. In seiner schriftlichen Hinterlassenschaft nimmt der ferne Vater Gestalt an.
Sharon beschließt, zu klären, wie ihr Vater gestorben ist, und den Ort zu finden, an dem seine sterblichen Überreste verborgen sind. Sie will ihren Vater heimholen, seinen Namen von dem Zusatz "MIA" ("Missing in Action") befreien und ihn begraben.
In den Archiven ermittelt sie die Namen einiger Kameraden ihres Vaters. Berichte über die Einsätze des 428. Fighter Squadrons tauchen auf und auch Dokumente, die den verhängnisvollen Flug am 13. April belegen. Alles deutet darauf hin, dass die P-38 des Lieutenants Shannon Estill über Sachsen von der deutschen Flugabwehr abgeschossen wurde. Doch die DDR erlaubt es den Amerikanern nicht, nach Vermissten zu suchen.
Die Suche geht weiter
Als die Mauer fällt, geht die Suche weiter. Und nicht nur Taylor schöpft neue Hoffnung, sondern auch Hobbyforscher wie Hans-Günther Ploes. Er hat sich darauf spezialisiert, vermisste Weltkriegs-Flugzeuge aufzuspüren - und mit dem Ende der DDR hat sich sein Einsatzgebiet erheblich vergrößert. Sharon Taylor und Ploes nehmen Kontakt auf. "Ich wusste von Anfang an, dass es eine schwierige Suche würde", so Ploes. "Im Chaos des Kriegsendes gingen viele wertvolle Akten verloren."
Die wenigen Spuren, die es gibt, führen nach Elsnig. Der Deutsche und die Amerikanerin treiben Zeitzeugen auf, die das Ende von Estills Feindflug gesehen haben. Demnach hat seine Maschine einen Volltreffer erhalten und ist noch in der Luft explodiert - Estill hatte keine Chance zu überleben.
Die Recherchen der beiden sind so gründlich, dass das auf Hawaii stationierte JPAC ein Team in die sächsische Provinz entsendet. Die Experten graben und graben und sichern schließlich tatsächlich Knochenreste. Später wird ein Labor zu dem Ergebnis kommen: Shannon Estill und seine "Lightning" sind gefunden.
Oktober 2006, Arlington Friedhof, Virginia, USA. Eine Ehrenformation, die "Honour Guards", feuert Salutsalven in den Himmel, zwei Jäger donnern über das offene Grab von Shannon Estill. Sharon Taylor hat ihr Versprechen eingehalten. Sie hat ihren Vater nach Hause gebracht. "Ich glaube", sagt sie, "er würde sich darüber freuen." Ganz sicher ist sie nicht. Sie hat den Mann, den sie über Jahrzehnte hinweg gesucht hat, in ihrem Leben niemals gesehen.
Spiegel TV Spezial strahlt die Reportage "Eine Liebe in Zeiten des Krieges - Der letzte Flug von Lieutenant Estill" am Samstag, 26. Mai, um 22 Uhr bei Vox aus.
http://www.spiegel.de/panorama/zeitgeschichte/0,1518,485069-2,00.html
24. Mai 2007, 17:56 Uhr Von Franziska von Mutius und Barbara Jänichen
Vaterschaftsprozess
Ermittlungen gegen Paul McCartney eingestellt
Eine Sorge weniger für Paul McCartney: Die Berliner Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen den Ex-Beatle wegen angeblichen Betrugs in einem Vaterschaftsprozess vor über 20 Jahren eingestellt. Eine Berlinerin verliert den Kampf.
Foto: APDie Berliner Staatsanwaltschaft ermittelte gegen Paul McCartney wegen Betrugsverdachts
Die Nachricht der Staatsanwaltschaft erschütterte Bettina K. „Das kann nicht sein. Das ist ein Hammer. So werde ich nie meinen Frieden finden.“ Weiterführende links
Berlinerin will Paul McCartneys Tochter sein Ein Leben mit Frauen und Joints Die 46 Jahre alte Altenpflegerin aus Tiergarten hatte Paul McCartney, den millionenschweren Ex-Beatle-Frontmann, wegen Betrugs bei der Staatsanwaltschaft Berlin angezeigt. Sie behauptet, McCartneys uneheliche Tochter zu sein, der Sänger habe die Vaterschaft nie anerkannt und bei der Abgabe einer Blutprobe im Jahr 1984 mit Hilfe eines Doppelgängers geschummelt. Vor kurzem ging sie zur Staatsanwaltschaft, erstattete Anzeige, erhoffte sich eine neue Prüfung des damals eingestellten Verfahrens. Doch gestern kam die Ernüchterung. Die Staatsanwaltschaft teilte mit: Die Auswertung der Akte von 1984 habe ergeben, dass die „behauptete Straftat in diesem Zusammenhang – selbst, wenn es sie gegeben hätte – heute verjährt wäre.“ Weiteren Ermittlungen stehe somit das Prozesshindernis der Verjährung entgegen.
Warum ließ Bettina K. die Frist (für Betrug: fünf Jahre) verstreichen?
„Der Betrug fiel mir erst in diesem Jahr auf. Ich habe meinen damaligen Anwalt mehrfach gebeten, die Akte einsehen zu dürfen. Erst sagte er, ich solle die Blätter kaufen, später sagte er: die Akte sei längst im Reißwolf.“ Dann habe sie ihre beiden Kinder zur Welt gebracht, sich darauf konzentriert. „Erst in diesem Jahr kontaktierte ich das Amtsgericht in Schöneberg. Das teilte mir überraschend mit, die Unterlagen existierten noch. Ich fand darin das Polaroid, das definitiv nicht Paul McCartney zeigt. Da wurde mir klar, er hat betrogen“, sagt Bettina K. „Hätte ich früher Einblick gehabt, hätte ich schon damals Einspruch erhoben.“ Schlagworte
Paul McCartney Bettina K. Beatles Klage Vaterschaft Blutprobe Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft löscht nun auch den letzten Hoffnungsschimmer, den Bettina K. noch hatte. Für den 31. Mai war die zweifache Mutter erstmals zu einer zeugenschaftlichen Aussage bei der Kriminalpolizei in Tiergarten geladen. Für den Vormittag hatte sie schon Beweismaterial zurechtgelegt und „zwei wichtige Zeugen“ mobilisiert, die zum Bekanntenkreis von McCartney gehört hätten. Denen habe der weltberühmte Sänger einst gestanden, dass er bei der Blutprobe getrickst habe.
Es geht ihr nicht um einen möglichen Erbanspruch
„Der Termin bei der Kripo ist mit der staatsanwaltlichen Entscheidung hinfällig“, sagte gestern Michael Grunwald, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. „Ich verstehe die Welt nicht mehr“, sagte Bettina K. gestern. „Ich will, dass mein Vater endlich zu mir steht. Und dafür bestraft wird, dass er betrogen hat. Es geht mir nicht um einen möglichen Erbanspruch. Darüber habe ich bis heute gar nicht nachgedacht.“ Bettinas Mutter Erika H., die Anfang der 60er-Jahre mit McCartney in Hamburg ein Verhältnis mit Folgen gehabt haben soll, war sprachlos. „Ich bin empört. Das wird meine Tochter nicht auf sich beruhen lassen.“ Der Fall McCartney, er beschäftigt Bettina K. seit 33 Jahren. Und lässt ihr keine Ruhe. „Als ich dreizehn war, habe ich herausgefunden, dass mein Stiefvater nicht mein echter Vater ist. Ich habe rumgeschnüffelt und in einem Schrank alte Briefe und das Tagebuch meiner Mutter gefunden. Ich habe mich ein Jahr lang nicht getraut, sie darauf anzusprechen. Eines Tages erzählte sie mir dann von ihrer Liebe zu Paul McCartney“, erinnert sich Bettina K. Auch ihre Großmutter habe ihr von der Liebe ihrer Tochter zu der britischen Pop-Legende berichtet. „Sie hat mir sogar gesagt, dass mein Großvater ihn rausgeschmissen hat, weil er Ausländer war. Meine Mutter hat sich vier Monate lang nicht getraut, ihren Eltern überhaupt zu sagen, dass sie schwanger ist.“ Die Wahrheit in der Angelegenheit Vaterschaft wird wohl nie ans Tageslicht kommen.
www.welt.de/berlin/article894735/Ermittlungen_gegen_Paul_McCartney_eingestellt.html
(19.02.2007)
Herz mit neuer Hoffnung
1961: große Liebe, dann verschwindet ein Mann. Nun verfolgt seine Frau besonders aufmerksam, ob sich die Lage in Nordkorea ändert
Von Björn Rosen, Jena
Als ihr Mann sehr plötzlich nach Pjöngjang aufbrechen muss, trägt sie ihr zweites gemeinsames Kind schon in sich. Sie werden ihm hinterherreisen, denkt sie. Dass es dazu nicht kommen wird, ahnt Renate Hong in diesem Moment nicht.
Seine Briefe bewahrt sie heute sorgfältig in Pappkartons und Klarsichtfolien auf. Sie sind alles, was ihr außer Erinnerungen von dieser Liebe bleibt. Denn irgendwann kam kein Lebenszeichen mehr aus Nordkorea. Renate Hong hat gehofft, getrauert, sich nicht wieder verliebt. Irgendwann hat sie aufgegeben, 46 Jahre sind eine lange Zeit. Sie konnte nicht mehr glauben, ihn wiederzusehen. Bis dieses Schreiben kam.
Das Auswärtige Amt teilte ihr Ende Januar mit, dass der Mann, den sie suche, noch lebt. Auch was sie seither in den Zeitungen liest, macht Renate Hong wieder etwas Hoffnung. Mag sein, es ist schwieriger denn je, nach Nordkorea einzureisen. Doch das abgeschottete Nordkorea und der Rest der Welt verhandeln wieder miteinander. Immerhin.
„Sehr, sehr schöne Nachrichten“, sagt Renate Hong. Sie spricht langsam, ihr Ton ist nüchtern. Aber die Neuigkeiten der letzten Wochen haben sie aufgewühlt. Wenn sie von Ok-geun spricht, blickt sie auf den Couchtisch und streicht die Tischdecke glatt. Sie war 23, als er aus ihrem Leben verschwand, heute ist sie 69.
Renate Hong wohnt im neunten Stock eines Plattenhochbaus im Jenaer Stadtteil Lobeda, durch die Fenster ist die Autobahn Richtung Berlin zu sehen. Ein Buch des Journalisten Peter Scholl-Latour liegt herum, er schreibt darin auch über Nordkorea. Sie versucht immer noch, dieses Land zu verstehen. „Aber es gelingt mir nicht.“ Sie hatte aufgegeben, aber doch nicht ganz. Sie trägt noch den Namen ihres Mannes. Er steht im Telefonbuch, am Klingelschild und auf der Post, die sie bekommt. Renate Hong hat nie daran gedacht, ihn abzulegen – obwohl sie ihre Ehe formal vor 18 Jahren annullieren ließ. „Der Name“, sagt sie, „erinnert mich an die schönste Zeit meines Lebens.“
Diese Zeit begann im Jahr 1955. Renate Hong ist damals 18 Jahre alt und schreibt sich an der Uni Jena für Chemie und Biologie ein. Zur gleichen Zeit kommen rund 100 Austauschstudenten aus sozialistischen Bruderstaaten an die Universität, Rumänen, Bulgaren, Chinesen, Nordkoreaner; einer von ihnen ist der 21-jährige Ok-geun. Die Gäste sind eine Attraktion in Jena. Sie leben in einem eigenen Wohnheim. Im Hörsaal hat man für sie Plätze in der vordersten Reihe reserviert. Dort sieht Renate Hong ihren späteren Mann zum ersten Mal. Beim Immatrikulationsball kurz nach Semesterbeginn fordert er sie zum Tanz auf. Eine Band spielt Dixieland-Jazz und deutsche Schlager. Renate Hong trägt ein langes, grünliches Ballkleid, der Koreaner einen dunkelblauen Anzug. „Es war“, sagt Renate Hong heute, „Liebe auf den ersten Blick“.
Was ihr an ihm imponiert, sind seine Zuversicht und sein Humor. Renate Hong ist nicht nur überrascht, wie aufgeschlossen und locker Ok-geun ist. Sondern auch, wie viele Freiheiten die Koreaner genießen. Anders als die chinesischen Gaststudenten, die in Jena alles gemeinschaftlich unternehmen müssen.
Aber auch die Nordkoreaner haben einen Aufpasser aus der Heimat. Er kommt nachmittags ins Wohnheim und kontrolliert, ob die koreanischen Studenten an ihren Schreibtischen sitzen und lernen. Für den Aufenthalt in der DDR wurden nur die Besten ausgewählt; Nordkorea will, dass die Studenten mit dem Wissen aus Deutschland beim Wiederaufbau ihres durch den Koreakrieg schwer zerstörten Landes helfen. Dass sie über das Studium hinaus im Ausland bleiben, steht nie zur Debatte. Renate und Ok-geun Hong planen daher, gemeinsam nach Nordkorea zu gehen. Heute kommt ihr das naiv vor.
„Sicher hatten wir zu viele Illusionen. Wir konnten uns nicht vorstellen, je wieder getrennt zu sein“, sagt Renate Hong. Sie steht von ihrem Sofa auf und holt ein leicht vergilbtes Heft im DIN-A5-Format aus dem Wandschrank. Ein Heft mit chemischen Formeln, er hat es bei seiner Abreise vergessen. Es erinnert sie daran, wie schnell er Deutsch lernte. Und an seine Briefe. „Sie waren immer sehr schön formuliert.“ Für einen Moment wirkt Renate Hong sehr glücklich.
Auch Anfang des Jahres 1960 sah es nach Glück aus. Beide schließen ihr Studium ab. Im Februar heiraten sie, im Juni das erste Kind. Sie nennen den Sohn Hjon-zol, schließlich soll er in Nordkorea aufwachsen. Ok-geun erfährt, dass er ein weiteres Jahr in der DDR bleiben kann, um ein Praktikum in einem Chemiefaserwerk zu absolvieren. Im April 1961 aber gibt die nordkoreanische Botschaft in der DDR bekannt, dass Nordkoreaner das Land sofort verlassen müssen. Die Order kommt unerwartet, der Grund bleibt unklar. Möglich, dass das Regime in Nordkorea darauf reagiert, dass einige Landsleute aus der DDR nach Westdeutschland geflüchtet sind. Ok-geun soll sich binnen drei Tagen auf die Heimreise machen.
Der Tag des Abschieds hat sich in Renate Hongs Gedächtnis eingebrannt. Saalbahnhof, Jena. Sie trägt Hjon-zol auf dem Arm und einen zweiten Sohn im Leib. Sie hat Tränen in den Augen, wie ihr Mann, obwohl sie glauben, dass sie bald in Nordkorea zusammenleben werden.
Anfangs schreibt Ok-geun, „wie sehr er uns vermisst und wie hart das Leben in Nordkorea ist“, sagt Renate Hong. Später werden die Botschaften seltener, kürzer, irgendwann klingen sie formal. Ok-geun deutet an, dass die nordkoreanischen Behörden Post abfangen. Zwei Jahre nach seiner Abreise kommt keine Post mehr.
Renate Hong glaubt, dass der Kontakt von Nordkorea unterbrochen wurde. Ehen mit Ausländern waren in der dortigen Diktatur nicht erwünscht, Pjöngjang erkannte sie nicht an. Renate Hong bat die nordkoreanische Botschaft, ihrem Mann eine Reise in die DDR zu genehmigen. Die Antwort: Ok-geun werde in Nordkorea gebraucht. Das DDR-Außenministerium gibt Renate Hong zu verstehen, es habe nichts gegen eine Einreise von Ok-geun, aber man könne nicht sie nach Nordkorea lassen. Offizielle Begründung: Andere Frauen aus der DDR habe man von dort zurückholen müssen, weil sie nicht zurechtgekommen seien. Die katastrophale materielle Situation et cetera.
Renate Hongs Elan erlahmt. Sie arbeitet als Chemielehrerin, später in einer Arzneimittelfirma, sie hat einen Alltag zu bewältigen, zwei Kinder großzuziehen. In den 80er Jahren trifft sie zufällig einen alten Studienkameraden. Er sagt, ihr Mann lebe – in Hamhung. Sie lässt Ok-geun eine mündliche Botschaft übermitteln. Ob der Freund die Wahrheit gesagt, ob ihre Nachricht Ok-geun erreicht hat, weiß sie nicht. Nie kam etwas zurück.
Es fände sich in einer ihrer Kisten, wenn es so wäre. In drei Fotoalben hat Renate Hong dokumentiert, wie die beiden Söhne erwachsen wurden. „Ich dachte, das würde ihren Vater interessieren, sollte er es sich eines Tages anschauen können.“ Den älteren Sohn nennen inzwischen alle bei seinem deutschen Namen: Peter. Der jüngere, Uwe, ist wie sein Vater Chemiker geworden.
Die Frage ist, ob der Vater davon erfahren wird. Denn die ermutigenden Nachrichten sind das eine. Aber Nordkorea hat sich nach dem Zusammenbruch verbündeter kommunistischer Staaten noch stärker abgeschottet.
Doch im vergangenen Jahr hat Renate Hong noch einmal versucht, Ok-geun aufzuspüren. Auf einer Geburtstagsfeier hatte sie einen südkoreanischen Doktoranden kennengelernt. Sie erzählte ihm ihre Geschichte, er stellte sie ins Internet. Ein Journalist aus Südkorea erfuhr davon, er machte den Fall bekannt und riet Renate Hong, sich an das Auswärtige Amt zu wenden. Zwei Monate später kam die überraschende Nachricht. Der internationale Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes hatte herausbekommen, dass Ok-geun noch lebt. DRK und das Auswärtige Amt bieten weiter ihre Hilfe an. Renate Hong könnte demnach versuchen, eine Rot-Kreuz-Nachricht an ihn zu senden, einen Brief, der nicht verschlossen werden und keine politischen Inhalte enthalten darf. Das DRK würden den Brief übergeben. Nur, ob er Herrn Hong erreicht, weiß niemand.
Und was, wenn es so kommt. Wenn aber Herr Hong nichts mehr von seinem früheren Leben wissen will?
Das kann sich Renate Hong nicht vorstellen. Sie weiß, es ist unwahrscheinlich, dass sie ihn noch einmal sehen wird. Aber eben nicht ausgeschlossen. Sie weiß, dass Ok-geun in Nordkorea wohl nicht alleine geblieben ist und eine neue Familie hat. Sie würde das verstehen.
Aber schön wäre doch, wenn sich die Söhne und der Vater kennenlernten. Der Vater, glaubt Renate Hong, wäre stolz auf die Jungs.
http://www.tagesspiegel.de/dritte-seite/archiv/19.02.2007/3092389.asp
Don’t Come Knocking
Die Helden sind müde
Der Cowboy-Darsteller Howard Spence (Sam Shepard) hat schon bessere Tage gesehen, früher war er so etwas wie ein Star, doch der Ruhm der vergangenen Tage ist ebenso brüchig geworden wie seine Seele. Manchmal sehnt er sich den Tod herbei, der ihn von seinem Leben als drittklassiger Mime befreit. Nach einer durchgesoffenen Nacht haut er einfach ab vom Set des C-Movies und hinterlässt viele leere Flaschen und einen fluchenden Regisseur. Auf seiner Flucht tauscht er die Insignien seines abgebrochenen Daseins, das Pferd und sein Kostüm gegen ein paar Klamotten ein.
Um wenigstens etwas Halt in seinem ziellosen Leben zu finden, flüchtet sich Spence zu seiner Mutter (Hitchcock-Ikone Eva Maria Saint), während er von einem Versicherungsdetektiv namens Sutter (Tim Roth) verfolgt wird. Bei seiner Mutter erfährt Spence etwas, das seinem Leben ein Ziel gibt – er soll angeblich ein Kind haben. Der Lost Cowboy ist von dieser Nachricht wie vom Donner gerührt. Und das unverhoffte Ereignis gibt seinem planlosen Treiben plötzlich wieder eine Richtung. Voller Hoffnung und Enthusiasmus macht er sich auf in jenen Ort in Montana, in dem er einst einen längst zu einem Kultfilm gewordenen Western drehte. Doch die Begegnung mit der hübschen Kellnerin und damaligen Affäre Doreen (Sam Shepards Lebensgefährtin Jessica Lange) und deren Sohn Earl (Gabriel Mann) verläuft ganz anders, als sich Spence das erhoffte. Und dann ist da noch die junge Frau Skye (Sarah Polley), die ständig die Urne mit der Asche ihrer Mutter herumträgt.
Wim Wenders neuer Film Don’t Come Knocking, der bei den Filmfestspielen von Cannes teilweise beinahe frenetisch gefeiert wurde, knüpft nahezu nahtlos an Highlights des Werks von Wenders an, in erster Linie fühlt man sich vor allem an den Klassiker Paris, Texas erinnert, was natürlich auch am Drehort und dem Grundmotiv der beinahe schon esoterisch anmutenden Suche nach sich selbst liegt. Doch es ist vor allem die Art, mit der Wenders uramerikanische Mythen aufgreift, bearbeitet und dekonstruiert, die an frühere Erfolge denken lassen. Sam Shepard als Howard Spence ist ein ähnlich gebrochener und vom Leben gezeichneter Charakter wie damals Harry Dean Stanton und man sieht beiden förmlich in ihren zerfurchten Gesichtern an, welche Mühsal das Leben für sie ist. Sie jagen ihren Träumen, Sehnsüchten und auch den Gespenstern von damals hinterher, doch die Zeit hat sich verändert und sie haben vergessen, die Veränderungen mitzumachen. So ist es denn auch kein Wunder, wenn Doreen und Earl überhaupt nicht erfreut sind, als Howard meint, dreißig Jahre einfach ungeschehen machen zu können. Und wo die Männer respektive die Väter so sehr versagen wie in Don’t Come Knocking, müssen eben die Frauen ihnen den Weg weisen und den Kopf zurecht rücken, was Jessica Lange auf wirklich sehr sehenswerte weise tut.
Don’t Come Knocking ist ein sehenswerter, faszinierender Film, bei dem nahezu alle Register höchster filmischer Meisterschaft gezogen werden, angefangen von betörenden, nahezu hypnotischen Bildern über die flirrende Musik von T-Bone Burnett über ausgezeichnete Schauspieler bis hinzu einer Geschichte, die wichtige Themen wie Identität, Liebe und das Leben mit den Fehlern der Vergangenheit anspricht, ohne den Zeigefinger zu erheben. Der einzige kleine Wermutstropfen für meinen Geschmack ist zugleich die bereits angesprochene Nähe zu Paris, Texas: Es scheint sich einfach nicht viel in der Welt von Wim Wenders verändert zu haben, die Sichtweise, die Menschen und ihre Themen, sie ähneln einander doch sehr. Aber das hat andererseits auch etwas sehr Beruhigendes an sich.
Daten und Fakten Titel:
Don’t Come Knocking
Regie:
Wim Wenders
Länge:
122 (Min)
Verleih:
Reverse Angle Pictures / UIP
Startdatum:
25.08.2005
Produktionsort/- jahr:
Deutschland 2005
Hauptdarsteller: Sam Shepard, Jessica Lange, Tim Roth, Sarah Polley, Eva Marie Saint
http://www.kino-zeit.de/filme/artikel/3369_dont-come-knocking.html
Verschwiegene Eltern
Viele nehmen das Geheimnis mit in den Tod: Tausende von Kindern ehemaliger Besatzungssoldaten kennen ihre Abstammung nicht
Von Sandra Dassler
Das Foto fällt Camille McCullen im Frühjahr 2004 in die Hände. Da sichtet die farbige Amerikanerin in Memphis, Tennessee, den Nachlass ihrer kurz zuvor gestorbenen Großeltern.
Auf der Rückseite des Fotos steht „Misters mother“. Mister ist der Spitzname von Camille McCullens Vater, Charles Reese. Der kann auf dem Foto höchstens eineinhalb Jahre alt sein. Er sitzt, etwas mürrisch schauend, auf dem Arm einer jungen Frau. Wie eine Mutter eben ihr Kind trägt. Aber es ist nicht die Frau, die McCullen immer für ihre Großmutter hielt. Die Frau, die der flüchtige Schriftzug auf der Rückseite des Fotos zu „Misters Mutter“ erklärt, ist weiß.
McCullen zeigt das Foto ihrem Vater. „Wer ist das? Und wo ist das?“ Ihr zuliebe versucht Charles Reese sich zu erinnern. Er ist 59, seine Eltern, sagt er, haben ihm einmal von seiner Adoption erzählt. Er kennt ein paar deutsche Wörter, auch den Namen einer Frau: Edith. Charles Reese hatte immer vermutet, dass sein Vater, der während des Krieges Soldat in Deutschland war, dort ein Kind mit einer deutschen Frau hatte. Und dass er dieses Kind ist. Aber nachgefragt hat Charles Reese bei seinen Eltern nie.
* * *
So ähnlich fangen viele Geschichten an, die Ute Baur-Timmerbrink in den vergangenen Jahren zu hören oder lesen bekam. Die Geschichten verfolgen sie manchmal Monate lang. Sie schleichen sich nachts in ihre Träume, kommen ihr in den Sinn, wenn sie Klavier spielt oder lassen sie bei alltäglichen Handgriffen plötzlich innehalten. Ute Baur-Timmerbrink, 59, Berlinerin, kennt die Gefühle von Camille McCullen und deren Vater Charles Reese in Tennessee. „Ich habe selbst erst vor sieben Jahren erfahren, dass meine Biografie falsch ist“, sagt sie. Und seitdem hilft sie dabei, die von anderen aufzuklären.
Geahnt habe sie schon als Kind, dass etwas nicht stimmte. Ihre Eltern verhielten sich anders als die Eltern ihrer Freunde – vor allem der Vater. Irgendwie sei sie sich wie ein Störenfried vorgekommen. „Man kann das schwer beschreiben“, sagt sie. „Es sind Gesten, die man als Kind beobachtet, ein Senken der Stimme, wenn man in ein Gespräch hineinplatzt. Und immer das Gefühl, da ist etwas Unausgesprochenes, Ungeklärtes, Falsches.“
Deshalb war es eine Befreiung, als sie an ihrem 52. Geburtstag von einer Freundin erfuhr, dass sie das Kind eines amerikanischen Soldaten sei. „Da konnte ich plötzlich alles verstehen. Vor allem, warum mein Vater, den ich verehrt und geliebt habe, mich nie wirklich an sich herankommen ließ. Ich muss ihn immer an den Fehltritt seiner Frau erinnert haben.“
Ute Baur-Timmerbrink hat sich auf die Suche nach ihrem amerikanischen Vater gemacht. Stieß dabei auf Trace, ein Netzwerk in England, das Besatzungskindern hilft, ihre GI-Väter aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden. „Die Leute von Trace haben mir geholfen, meine Herkunft zu klären. Seitdem arbeite ich selbst für die Organisation, kümmere mich um Anfragen, die den deutschsprachigen Raum betreffen.“
Das schmale Arbeitszimmer ihrer Wohnung in Berlin-Heiligensee hat Ute Baur-Timmerbrink ganz dieser Aufgabe gewidmet. Nur die Fotos ihrer beiden Söhne können sich gegen die fremden Schicksale behaupten, die akkurat in Aktenordnern zusammengefasst, in den Regalen stehen. Wenn Ute Baur-Timmerbrink ins Erzählen kommt,erzählt ihr ganzer Körper mit, ihr Gesichtsausdruck wechselt von fröhlich zu traurig, von amüsiert zu nachdenklich. Arme und Hände gestikulieren ohne Pause. Ihre Augen aber geben den Gegenüber nicht eine Sekunde frei, während sie Episode an Episode aneinander reiht, Erklärungen dazwischenschiebt, Situationen beschreibt, die eigentlich nie hätten eintreten sollen.
Da ist beispielsweise der 82-jährige Witwer in Puerto Rico, der seine Angehörigen auf einer Familienparty mit der Nachricht schockierte, dass er sich als Soldat in Nachkriegsdeutschland in eine Frau verliebt hatte. Nie habe er sich verzeihen können, dass er diese Frau verließ und auf Wunsch seiner Eltern in Puerto Rico eine andere heiratete. Das ganze Leben habe er sich mit dieser Geschichte herumgeschlagen. Sein einziger Wunsch sei, die einstige Geliebte vor seinem Tod zu finden. Und das Kind, das sie damals von ihm erwartete.
Ute Baur-Timmerbrinks Augen funkeln, wenn sie schildert, wie sie die Frau gefunden hat. Fast immer schaltet sie die örtliche Zeitung ein, um Leute zu erreichen, die damals lebten und sich erinnern. Auch Standes- und Einwohnermeldeämter erweisen sich als nützlich. Über eine Anfrage dort hat Ute Baur-Timmerbrink die gesuchte Frau in einem Pflegeheim in Süddeutschland entdeckt. Schwer demenzkrank. Nicht mehr ansprechbar. Verwandte der Frau erzählten ihr, dass das Kind des Puertoricaners, ein Mädchen, schon im Alter von einem Jahr gestorben ist. Ute Baur-Timmerbrink hat diese Nachricht nach Übersee gemailt. Die Gewissheit, sagt sie, bringe zwar erst Trauer, aber später auch Seelenfrieden. Und sie ermöglichte den Suchenden, eine Art Schlussstrich zu ziehen.
Das Statistische Bundesamt gibt die Zahl der zwischen 1945 und 1955 in den drei Westzonen einschließlich West-Berlins geborenen Kinder alliierter Besatzungssoldaten mit 68 000 an. Es sind wohl mehr. Viele Ehepaare vereinbarten Stillschweigen, und oft schwiegen auch Verwandte und Bekannte ein Leben lang.
60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stirbt die Generation der damals 20-Jährigen langsam aus. Manche beichten auf dem Sterbebett, andere nehmen ihr Geheimnis mit in den Tod. Erst danach erfahren ihre Kinder aus lange verborgen gehaltenen Dokumenten von ihrer wahren Herkunft. Für manche ist das ein Schock. Und nicht selten übernehmen die Enkel die Suche, weil sie damit einfach lockerer umgehen können.
„Alle meine Verwandten kannten die Wahrheit“, erzählt Ute Baur-Timmerbrink. „Und alle haben sie mit ins Grab genommen – auch meine Eltern.“ Eine Tante sagte ihr nur: „Von mir erfährst du nichts. Du warst nie eine von uns. Und du wirst deinen richtigen Vater nie finden.“
Aber Ute Baur-Timmerbrink wollte es wenigstens versuchen. Sie hat wieder Englisch gelernt, es war nicht gut genug, um amerikanische Quellen nutzen zu können. Sie hat Botschaften und Zeitungen angeschrieben. Sie ist in die kleine österreichische Stadt gefahren, wo ihre Mutter nach Kriegsende ihren leiblichen Vater, einen amerikanischen Offizier, kennen lernte. Und lieben, obwohl sie seit 1936 verheiratet war. Als ihr Ehemann Ende 1947 aus der Gefangenschaft zurückkam, fand er eine Tochter vor.
Und die Tochter fand den Amerikaner. Vor ein paar Jahren war es so weit, und Ute Baur-Timmerbrink musste akzeptieren, dass er sich nicht zu ihr bekennen wollte. Er ist Rechtsanwalt. „Ich passte nicht in die Welt, die er sich in den Staaten aufgebaut hat“, sagt sie: „Und aufdrängen wollte ich mich nicht.“
Was sie bei ihrer Suche gelernt hat, nutzt sie nun, um anderen zu helfen. Sie arbeitet ehrenamtlich, bekommt keinen Cent dafür, obwohl sie Kosten hat: Telefonate, Gebühren für Urkunden oder Dokumente, Benzingeld für Fahrten zu Ämtern und zu Freunden oder Verwandten der Gesuchten. Ute Baur-Timmerbrink sagt: „Bei der Suche nach meinem Vater haben mir auch viele Menschen geholfen, ohne zu fragen, was sie dafür bekommen.“
Die Anfrage, die Camille McCullen aus Tennessee nach dem Hinweis eines Freundes an Trace sendete, landete im Mai 2004 bei Ute Baur-Timmerbrink. McCullen hatte mehr wissen wollen über diese weiße Großmutter. Vielleicht lebte sie ja noch. Vielleicht hatte ihr Vater Geschwister in Deutschland. Und vielleicht wäre seine Mutter glücklich, etwas von ihrem Sohn zu hören.
Ute Baur-Timmerbrink fand heraus, dass McCullens Vater am 21. Juli 1946 als Sohn von Oskar und Edith Lange geboren wurde. Der Ehemann von Edith Lange war seit Kriegsende vermisst, aber nicht für tot erklärt worden. Daher galt der dunkelhäutige Junge nach Recht und Gesetz als ehelich geborenes Kind von Oskar Lange. Dass er bei der Geburt den Namen Karl-Heinz Hubertus erhalten hatte, wussten die Suchenden aus Amerika. Auch, dass er irgendwo in der Nähe von Berlin das Licht der Welt erblickte – in „Baddensorrow“. Ute Baur-Timmerbrink hat eine Weile gebraucht, bis sie dahinter kam: Baddensorrow? Natürlich – Bad Saarow. Edith Langes Adresse war damals der Saarower Kronprinzendamm 6 - 8. Dort befand sich ein Mütter- und Säuglingsheim, in dem viele Frauen aus Berlin und dem Umland ihre Babys zur Welt brachten.
Abgesehen von den allgemeinen Schwierigkeiten, in der Nachkriegszeit ein Kind durchzufüttern, hatten es die Geliebten der Besatzungssoldaten besonders schwer – vor allem, wenn ihre Kinder farbig waren. „GI brown babies“ heißen diese Kinder heute noch in den Vereinigten Staaten – etwa 5000 „afrodeutsche Besatzungskinder“ gab es in der Bundesrepublik. Ihre Mütter wurden als „Amiliebchen“ verhöhnt und nicht selten auf offener Straße angespuckt.
Es gab Mütter, die sich dem Hass und der Verachtung nicht aussetzen wollten und ihre Kinder zur Adoption freigaben. Viele dieser Kinder wurden über das von der US-Regierung ins Leben gerufene Programm „Brown Baby Plan“ an amerikanische Eltern vermittelt. Dass die leiblichen Väter ihre in Deutschland geborenen Kinder adoptierten – so wie im Fall von Charles Reese aus Tennessee –, war eher selten.
Seine Mutter Edith Lange, so berichtet ihre Schwägerin, die Ute Baur-Timmerbrink durch einen Zeitungsartikel fand, habe lange gezögert, ihn zur Adoption freizugeben. „Sie meinte dann aber, dass sie den Jungen an den Amerikaner abgeben müsse, weil er es dort drüben besser haben würde.“
Wie mag es Edith Lange zumute gewesen sein an jenem 7. April 1948? Damals traf sie sich mit dem Ehepaar Reese bei einem Notar in Berlin-Zehlendorf. Die Amerikaner erklärten, dass sie „Karl Lange an Kindes statt“ annehmen. Edith Lange stimmte der Adoption zu und verzichtete auf alle Rechte an ihrem Sohn. Der Wert des Vertrages wurde mit 10 000 Reichsmark angegeben. Ob Edith Lange Geld bekam, lässt sich nicht mehr feststellen. Auch nicht, ob die Amerikaner der Deutschen Nachrichten oder Fotos ihres Sohnes zukommen ließen.
Fast 60 Jahre später freuten sich die vier Kinder und acht Enkelkinder von „Mister“ Charles Reese in Tennessee sehr über die Fotos ihrer Berliner Großmutter. Nach fast einem Jahr Recherche hatte ihnen Ute Baur-Timmerbrink viele Unterlagen schicken können. Sie fand heraus, dass Edith Lange als Arzthelferin bei einem Orthopäden am Olivaer Platz gearbeitet und zuletzt in der Pfalzburger Straße in Berlin-Wilmersdorf gewohnt hatte. Nachbarn erzählten, dass sie kinderlos und nicht verheiratet war. Allerdings habe sie zu Kindern immer eine besondere Beziehung gehabt und jahrelang die Sprösslinge verschiedener Berliner Familien betreut.
Für ein Wiedersehen mit ihrem Sohn war es zu spät. Am 13. Mai 1996 ist Misters mother im Hubertus-Krankenhaus in Berlin-Zehlendorf gestorben.
"Der Tagesspiegel", 24.01.2006
http://www.tagesspiegel.de/dritte-seite/archiv/24.01.2006/2305962.asp#art
"Problemjugendliche auf der Suche nach dem verlorenen Vater. Zur Notwendigkeit differenzierter theoretischer Beschreibungen in der Erlebnispädagogik und deren Konkretisierung am Beispiel eines delinquenten Adoleszenten"
Rauh, Bernhard / Wildenhues, Claudia: In: "Neue Praxis", 6/2005, S. 611-624
"Bruno Sattler - mein `unschuldiger` Vater",
Beate Niemann in: "Horch und Guck", Heft 48, 4/2004
Eine Tochter auf den Spuren ihres in der DDR vermeintlich unschuldig zu langjähriger Haft verurteilten Vaters. Die Recherche der Tochter führt zur Erkenntnis, dass ihr Vater als Verantwortlicher im NS-Terrorapparat schuldig am Tod Tausender Menschen ist und im Krieg an Erschießungen persönlich mitgewirkt hat. Auch die Mutter ist an der Deportation und dem Tod einer jüdischen Frau mitschuldig geworden.
http://www.buergerkomitee.org/hug/h48-dateien/48inhalt.html
Der Tagesspiegel
Dritte Seite
27.04.2005
Der Feind im Kind
Sie wurden gehänselt, verstoßen, gehasst. Nicht nur die Frauen, die sich mit Besatzungssoldaten einließen, auch die gemeinsamen Kinder galten als Verräter. Jetzt sind sie aus ganz Europa nach Berlin gekommen
Von Claudia Keller
Wenn er den Krieg überlebt hätte, wäre ihr Vater bestimmt zurückgekehrt zu ihrer Mutter. Sie war ja seine große Liebe. 50 Jahre lang hat Mylène Lannegrand das geglaubt. Ihr Vater war der deutsche Besatzungssoldat Heinz Rosentreter. Heute weiß sie, dass er überlebt hatte. Zurückgekehrt ist er trotzdem nicht.
Mylène, eine kleine Frau mit blonden struppigen Haaren, ist noch einmal nach Berlin gekommen, wo sie vor vier Jahren ihrem Vater auf die Spur kam. Sie steht zwischen Metallregalen in der „Deutschen Dienststelle WASt“ in Berlin, der ehemaligen Wehrmachtsauskunftsstelle. In dem roten Backsteinbau in Reinickendorf lagern 18 Millionen Karteikarten, auf denen die Nazis verzeichneten, wann sich welcher Wehrmachtssoldat während des Krieges wo aufgehalten hat. In Kartei 919, Nummer 667, Buchstabe R, steckt die Karte von Heinz Rosentreter. Darauf steht, dass er nach seiner Stationierung in Frankreich 1942 in Russland leicht verwundet wurde. 1967 hat er eine Wehrdienstbescheinigung für seine Rente angefordert. 1983 starb er in Köln. Auch dass er eine Tochter hat, steht auf der Karte. Es ist nicht Mylène.
Als sie die Karte das erste Mal in der Hand hielt, hat sie geweint. „Weil ich so erleichtert war, dass ich ihn endlich gefunden hatte“, sagt sie. Zugleich sei sie traurig gewesen, dass sie zu spät kam. Nun ist sie wieder hier, weil die WASt zum ersten Mal Besatzungskinder aus verschiedenen Ländern eingeladen hat: Kinder von deutschen Wehrmachtssoldaten treffen sich mit Kindern amerikanischer, französischer und englischer Soldaten, die 1945 nach Deutschland kamen. Sie wollen ein „Büro der Kinder des Krieges“ gründen. „Weder in der Genfer Konvention noch in der Haager Landkriegsordnung gibt es eine Klausel über uns Kriegskinder. Das muss sich ändern. Wir sind schließlich ein Produkt dieser Kriege“, heißt es in ihrer Erklärung. Sie beklagen, dass sie bisher nach nationalem Recht behandelt werden, das sehr unterschiedlich ist, etwa, was den Zugang zu Archiven angeht. Hier müssten internationale Regelungen getroffen werden. Auch kämpfen sie dafür, dass sie innerhalb Europas die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen als nachträgliche Anerkennung ihrer Vaterländer. Ein fernes Ziel sei eine UN-Konvention der Kinder des Krieges – zum Schutz für zukünftige Kriegskinder.
Mylènes Mutter war 17, als sie sich in Heinz Rosentreter verliebte. Er kam 1940 in den kleinen Ort Fouras an der Atlantikküste und wohnte im „Hotel de la Mer“. Renée lebte bei ihrem Onkel und ihrer Tante, die das Hotel betrieben. „Für meine Mutter war es die große Liebe“, sagt Mylène. Der 28-jährige Deutsche sei so nett und höflich gewesen, habe immer Blumen gebracht. Er entsprach nicht dem Bild des ungehobelten „Boche“ der Kriegspropaganda.
Im Frühjahr ’41 wurde Rosentreter an die Ostfront abkommandiert. Dass seine Freundin schwanger war, wusste er nicht. Im Dezember wurde Mylène geboren.
In Frankreich gibt es schätzungsweise 200000 Kinder, die einen deutschen Soldaten zum Vater und eine französische Mutter haben und zwischen 1941 und 1945 geboren wurden. Die meisten kennen ihre Väter nicht.
Nachdem die deutschen Soldaten aus Frankreich abgezogen waren, schleiften Männer aus dem Dorf Mylènes Mutter und 20 andere Frauen auf den Platz vor der Kirche. Sie wurden als „deutsche Huren“ beschimpft, dann schor man ihnen den Kopf kahl. Mylènes Mutter verließ das Dorf, heiratete später einen Franzosen und zog mit ihm nach Bordeaux. Mylène wuchs bei der Großtante und dem Großonkel in Fouras auf. „Sie haben mir gesagt, dass ich stolz sein soll, einen deutschen Vater zu haben.“ Sie hat Klavier spielen gelernt, weil ihr Vater Klavier spielte, sie hat Jura studiert, weil er Jurist war. Sie trägt sogar seinen Namen als Mittelnamen: Heinz.
In der Schule sei sie gehänselt worden als „Tochter eines deutschen Schweins“. „Ich wollte beweisen, dass es gut ist, dass es mich gibt.“ Dafür reichte es nicht, gute Noten zu haben. Sie wollte die Beste sein. „Ich wollte strahlen, auch äußerlich.“ Sie schmückte sich mit Goldketten. Auch an diesem Tag trägt sie eine dicke Goldkette und mehrere Ringe.
Immer bohrten diese Fragen in ihr: Wer war Heinz Rosentreter? Hätte er mich gemocht? War er so, wie ihre Mutter ihn beschrieb, oder so, wie die Deutschen in der Karikatur: dick, mit Bierkrug? Als sie jünger war, drängte sie die Fragen beiseite, war beschäftigt mit Studium und Karriere, mit Ehe und Sohn. Was, wenn er noch am Leben ist? „Die Neugier wurde immer größer, aber auch die Angst, auf etwas zu stoßen, was mein Bild zerstört.“
Vor sechs Jahren hielt sie es nicht mehr aus. Sie ist frühzeitig in Rente gegangen, um ihren Vater zu suchen. Die französische Botschaft verwies sie an die Deutsche Dienststelle WASt. Weil sie seinen Namen wusste, fanden die Mitarbeiter die Karteikarte recht schnell. Auf ihr war nur ein Kind vermerkt, weitere Nachforschungen ergaben aber, dass Heinz Rosentreter vier Mal verheiratet war und neun Kinder hatte. In der ersten Ehe wurden fünf Kinder geboren, in der zweiten eines, ein weiteres in der dritten. Dazu kam das Kriegskind Mylène. Sie war nicht die älteste. Auch die deutschen Halbgeschwister wussten nicht alle voneinander.
Dass ihr Vater nicht der treue Liebhaber war, den sie sich erträumt hatte, habe sie nicht gekränkt. Sie ist glücklich über ihre neue Großfamilie. Mit ihrer jüngsten Schwester verbringt sie jedes Jahr den Sommer. Mylène nimmt die Karteikarte ihres Vaters immer wieder in die Hand. Auf der Rückseite stehen nun die Namen aller Kinder, auch ihr eigener.
Auch Franz Anthöfer ist ein „Kind des Feindes“, Sohn einer Deutschen und eines amerikanischen Soldaten. Anthöfers Suche nach dem Vater verlief weniger glatt, auch weil ihm US-Behörden den Zugang zu Akten verweigerten. Als er endlich seinen amerikanischen Verwandten gegenüberstand, schlug ihm die Schwester des Vaters mit der Hand ins Gesicht. Er erzählt das hastig, gleich nach der Begrüßung im Restaurant des Novotel in Tegel, verhaspelt sich immer wieder.
Seit Jahrzehnten pendelt Anthöfer zwischen Deutschland und den USA, verbringt jeden Urlaub in Archiven, streitet mit Behörden. Der abwesende Vater dominiert sein Leben.
Anthöfer wurde 1951 in Rastatt geboren, seine Mutter hatte sich in den amerikanischen Offizier Louis G. Craig verliebt. Anders als Mylène Lannegrands Mutter wurde sie von ihrer Familie aus dem Haus geworfen, als sie schwanger wurde. Sie fand eine Stelle in Köln bei der Lufthansa. Das uneheliche Kind wurde ihr vom Jugendamt weggenommen und in ein Heim gesteckt. Anthöfer wurde als „Ami-Bastard“ beschimpft und verprügelt. Amerika wurde in seiner Fantasie zur Zuflucht, wenn er sich wegträumte aus der lieblosen, ärmlichen Gegenwart.
Als er 14 Jahre alt war, gab seine Mutter seinen drängenden Fragen nach und sagte ihm, wie sein Vater hieß. Seine Sehnsucht konnte sich nun an einen Namen klammern. In der Anglican Church in Köln lernte der Jugendliche Englisch, fuhr mit dem Fahrrad nach Bonn, um im amerikanischen Club Filme zu schauen. Mit 21 flog er nach Washington und ging zu der einzigen Adresse, die er von seinem Vater hatte. Da wohnte kein Louis G. Craig mehr. Jahre später stöberte er die Spur schließlich in Weston auf, einer Kleinstadt in West Virginia. Doch Anthöfer kam zu spät: Drei Wochen zuvor war Louis G. Craig, Anwalt und Bürgermeister, gestorben. Nach dem Schlag ins Gesicht drohte Craigs Schwester, den „deutschen Bastard“ verhaften zu lassen, falls er sich noch einmal blicken lasse.
Aber Anthöfer wollte die amerikanische Staatsbürgerschaft, und dafür brauchte er hundertprozentige Sicherheit. 1996 ließ er die Leiche des Vaters exhumieren und eine DNA-Analyse machen. Sie brachte 99,9-prozentige Sicherheit, dass er der Sohn von Louis G. Craig in Weston ist. Ein Freund seines Vaters schrieb, notariell beglaubigt: „Ich kann bestätigten, dass Louis Craig mehrmals sagte, dass er sich wünsche, sein Sohn wäre bei ihm. Ich habe keinen Zweifel, dass Franz Anthöfer, der den gleichen Gang hat, das gleiche Gesicht und die gleiche Art, die Daumen in die Hüfte zu stemmen, der Sohn ist, von dem er immer gesprochen hat.“
Die DNA-Analyse hätte bei der Anerkennung der Staatsbürgerschaft vor Gericht Bestand, glaubt Anthöfer. Aber das Verfahren geht nicht weiter, weil er nicht zu den Verhandlungen kommen kann. 1997 blieb er länger als die im Touristenvisum zulässigen drei Monate in Virginia. Man schob ihn ab. Seitdem darf er nicht mehr einreisen.
Es ist spät geworden. Anthöfer will noch die Franzosen treffen, vielleicht können sie ihm helfen.
http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/27.04.2005/1782671.asp
Agatha und der Sturm ( AGATA E LA TEMPESTA )
Land/Jahr: IT/SCHWEIZ/GB 2004
Regie: SILVIO SOLDINI (Brot und Tulpen)
Darsteller: LICIA MAGLIETTA, GIUSEPPE BATTISTON, EMILIO SOLFRIZZI
Drehbuch: DORIANA LEONDEFF, FRANCESCO PICCOLO, SILVIO SOLDINI
120 Min. FSK: ohne
INHALT: Im Leben der 40jährigen Buchhändlerin Agata (Licia Maglietta) geht es buchstäblich stürmisch zu: In ihrer Nähe brennen nicht nur Glühbirnen durch, stürzen Computer ab oder beginnen Ampeln zu flackern, auch in ihrem Beziehungsleben herrscht das reinste Chaos. Ihr junger Geliebter Nico (Claudio Santamaria) ist verheiratet, scheint aber Frau und Freundin auch noch mit einer hübschen Blondine zu betrügen und beteuert, es handele sich alles um eine Verwechslung. Gleichzeitig behauptet ein gewisser Romeo (Giuseppe Battiston), der leibliche Bruder von Agatas geliebten Bruder Gustavo (Emilio Solfrizzi) zu sein. Für Agata beginnt eine aberwitzige Suche nach tatsächlicher Verwandtschaft, echten Gefühlen und sonstigen Lebenswahrheiten. Liebe nicht ausgeschlossen…
.........
Nach meinen zwei letzten Filmen – beide mit klassisch narrativer Struktur – empfand ich das Bedürfnis an einer Geschichte mit mehreren Handlungssträngen auf mehreren Ebenen zu arbeiten, schon bei meinem ersten Langfilm L’ARIA SERENA DELL’OVEST, aber in etwas ironischer und leichterer Form. AGATA UND DER STURM ist eine Komödie. Der Ton und die Atmosphäre ähneln denen von BROT & TULPEN aber durch die in sich verwobenen Erzählungen greift der Film das Leben in seiner Komplexität und Gegensätzlichkeit auf. Und Agata ist mitnichten so eine naive und einfache Frau Rosalba: Sie verfügt über eine bestimmte Kultur, ihre Vergangenheit ist durch emotionale Wirren geprägt, durch Sprünge und Unterbrechungen und immer wieder Neubeginn.
...........
Mit ihren über 40 Jahren hält sie ihr Leben fest in beiden Händen – sie einen Job, den sie liebt, eine zwanzigjährige Tochter, die flügge wird und sie verlässt. Ich porträtiere diese dynamische Frau in einem stürmischen Moment ihres Lebens. Nebenbei bringt Agata surreales Element in den Film ein – Glühbirnen zerplatzen in ihrer Gegenwart. Das ist etwas, was sie nicht versteht und was sie ängstigt. Eine Sache, die sie nicht in den Griff bekommt, bis zwei Jahre später ihr Leben in etwas ruhigeres Fahrwasser gerät und sie etwas gelernt zu haben scheint. Trotz aller Märchenhaftigkeit basiert die Geschichte auf einer uns allen bekannten Realität. Die Idee des Films liegt darin, die Charaktere in ihrer Vielfältigkeit zu zeigen, mit allem, was dazu gehört – Schwäche,Gegensätze, Herzlichkeit,Unvollkommenheit, dunkle Seiten, ihre Fähigkeit lustig und tiefschürfend zugleich zu sein, in ihrer ganzen Menschlichkeit. Silvio Soldini Regie
Nach dem preisgekrönten Publikumsliebling BROT & TULPEN verzaubert Italiens Meisterregisseur Silvio Soldini erneut mit einer warmherzigen Geschichte über die Zufälle des Lebens und der Liebe.
http://www.mmeansmovie.de/filmstart_dezember4_4.html#0
Ganz nebenbei schildert der Film auch die Suche von Gustavo nach seinem leiblichen Vater. Die Suche endet auf überraschende Weise erfolgreich.
"Problemjugendliche auf der Suche nach dem verlorenen Vater
Zur Notwendigkeit differenzierter theoretischer Beschreibungen in der Erlebnispädagogik und deren Konkretisierung am Beispiel eines delinquenten Adoleszenten"
Bernhard Rauh / Claudia Wildenhues
In: "Neue Praxis", 6/2005, S. 611-624
FAZ 19.02.2004
Internet
Teenager „ergoogelt“seine eigene Entführung vor 14 Jahren
19. Februar 2004 Ein 17jähriger Kalifornier hat nach 14 Jahren mit Hilfe des Internets entdeckt, daß er als Kind von seiner Mutter aus Kanada entführt worden ist. Nach Medienberichten vom Mittwoch fand der Schüler zufällig sein eigenes Foto auf einer Webseite für vermißte Kinder. Nach Polizeiangaben hatte der Vater des Jungen 1989 von einem Gericht das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekommen. Die Mutter floh dann mit dem Kind erst nach Mexiko und schließlich nach Kalifornien. Jetzt soll der Teenager mit seinem Vater wieder vereint werden, den er die ganze Zeit nicht gesehen hat.
Den Berichten zufolge gab der Junge vor einem Jahr im Schulunterricht rein zum Spaß seinen Namen in die Suchmaschine „Google“ ein und landete so auf der Webseite einer kanadischen Organisation, die beim Aufspüren verschwundener Kinder hilft. Dort stieß er zu seinem großen Schock auf ein Bild, das ihn als Dreijährigen zeigt. Der Teenager erzählte seinem Lehrer von der Entdeckung, der daraufhin die Behörden verständigte.
Die Polizei verfolgte ein Jahr lang die Spur der Mutter und verhaftete die 45-Jährige schließlich in der vergangene Woche in Los Angeles. Sie soll nun an die Behörden in Kanada ausgeliefert werden. Ein Polizeibeamter schilderte im kanadischen Fernsehen, der Junge sei sehr bestürzt über die Verhaftung seiner Mutter gewesen: „Er war schrecklich emotional.“ Vater Ron Steinmann sagte unterdessen, er habe sich Jahre lang Sorgen um seinen Sohn gemacht. „Ich habe mich gefragt, ob sie ihn ins Krankenhaus bringt, wenn er krank ist, und ob er zur Schule geht.“
Steinmann wartet nun gespannt auf das Wiedersehen mit seinem Sohn in Kanada, den er nur als Kleinkind in Erinnerung hat: „Ich bin mir darüber im Klaren, daß er inzwischen erwachsen geworden ist.“
Text: dpa
Bildmaterial: dpa/dpaweb
Vater, wer warst du?
Ein fremder Mann, nur ein Foto ohne Stimme – Wibke Bruhns war sechs, als die Nazis ihren Vater hängten. Jetzt hat sie sich auf die Suche in die eigene Vergangenheit begeben. Und vieles gefunden.
Von Norbert Thomma
Als sie 15 war, ist sie vom Internat geflogen, 1953; sie galt als ungehorsam, aufsässig. Der Schulleiter sagte ihr, das wundere ihn nicht, dieser schlechte Charakter: „Dein Vater war ja ein Hochverräter.“
Als sie erwachsen wurde, reagierten viele mit neugierigem Interesse. Ach, dein Vater hat mit dem 20. Juli zu tun? Was hat er denn gemacht? Das sei ihr peinlich gewesen, sagt sie, dieses Geschmücktwerden mit fremden Federn. „Nichts“, habe sie meist geantwortet, „aber aufgehängt haben sie ihn.“ Er war nicht direkt beteiligt am Versuch, Adolf Hitler mit Sprengstoff umzubringen, er hat davon gewusst und geschwiegen.
Als sie 41 war, kam sie von einer Auslandsreise zurück. Sie drückte eine Aufzeichnung über den Widerstand gegen die Nazis ins Videogerät, sah die Richter des Volksgerichtshofs in den Sitzungssaal eintreten, Hitlergruß, Hüte ab, und dann führen zwei Polizisten einen Mann vor den Richtertisch, von dem herab der berüchtigte Roland Freisler keift. Der Angeklagte ist ihr Vater. „Ist Ihnen klar“, bellt Richter Freisler, „dass nichts weiter tun Verrat war?“ Hans Georg Klamroth zögert mit gesenktem Blick, dann spricht er ein trotziges „Nein“ und schüttelt den Kopf. „Abartig“ ist aus Freislers Toben zu hören, „Abartigkeiten.“ Ein Todesurteil, August ’44, für den Major der Abwehr.
In diesem Moment hat Wibke Bruhns beschlossen, irgendwann das Leben ihres Vaters zu ergründen und aufzuschreiben*. Er war bis dahin „keine Kategorie“ für sie, präsent nur durch Fotos und Anekdoten der Verwandten, ohne den Klang einer Stimme. 1979 ist das gewesen.
Nun zupft sie die nächste Zigarette aus dem silbernen Etui. Draußen zerwirbelt der Wind dicke Schneeflocken. Das Sauwetter in Halberstadt lässt sich durch große, verglaste Türen beschauen. Hinter den kniehohen Mäuerchen, sagt sie, müssen sie sich Rhododendronbüsche vorstellen, dort habe ich als Kind meinen Lebertran entsorgt. Hinter dem Garten, wo die neu gebaute Sparkasse zu sehen ist, sagt sie, war unser Tennisplatz, dort drüben der Rosengarten, dort der Longierplatz für die Pferde. Wir sitzen gerade im ehemaligen Wintergarten, sagt sie.
In diesem Haus aus Sandstein hat alles angefangen. Hier wurde Wibke Klamroth geboren, letztes von fünf Kindern des Ehepaares Else und Hans Georg, geboren in ein Anwesen mit Gesindetrakt und Pferdeställen, die Einbauten aus Eiche und Mahagoni, alles im englischen Landhausstil und bis zu Lampen und Parkett entworfen vom Architekten Muthesius, 1911. Über Generationen verdienten die Klamroths an Handel, Landwirtschaft, Spedition; geschäftliche Beteiligungen reichten bis zur Karibikinsel Curacao. Firma „I. G. Klamroth“ – jeder erstgeborene Sohn bekam einen Namen mit diesen Initialen.
Die Dynastie zerbrach
Wibke Bruhns ist 65 inzwischen, schlank im schwarzen Anzug, cremefarben der Pullover, die blonden Haare kurz, ganz Dame. Aus dem Elternhaus am Ostrand des Harzes ist ein 4-Sterne-Hotel geworden, es gehört der Familie längst nicht mehr; Zimmer 266 war ihre Kinderstube, auf dem Balkon davor hauste ihr Kaninchen. Die Kellnerin bringt gebratene Gänseleber mit Wintersalaten.
Als die etwa 250 Bomber kamen damals, einen Sonntag nach Ostern 1945, saß sie unten im Keller. Halberstadt am Ostrand des Harzes verbrannte. Sie sagt, die Gedanken daran brächten sofort den prasselnden Lärm der Flammen zurück. Doch die Erinnerung an die Zeit davor sei bei ihr erloschen. Die ersten sechs Lebensjahre – weg; auch eine späte Psychoanalyse habe nichts davon zurückgebracht. Und die Dynastie der Klamroths war zerbrochen, zerstreut im Westen.
Vielleicht erzählt sie deshalb so frei von Sentimentalität. Halberstadt wurde DDR, das hat sie nur aus der Ferne betrachtet. Und der Vater, der war später kein Thema, die ganze Vergangenheit war keines. Die Mutter verstummte. Nur Freunde schilderten ihn ab und an als charmant, lebhaft, witzig. Du bist wie er, hörte sie oft. Wibke Bruhns drückt eine Zigarette aus. Im Aschenbecher liegen die vielen Stummel sauber aufgereiht wie Löffel im Besteckkasten. Ja, sagt sie lachend, ordentlich sei er auch gewesen.
Was sie sonst wusste vom Vater, den sie distanziert „HG“ nennt, um ja keine Vertrautheit anzudeuten, waren wenige Fakten: früh Mitglied in der NSDAP, in der SS; Kriegseinsatz zur Partisanenbekämpfung in Russland. Auch die Mutter ging zeitig in die Partei, NS-Frauschaft. Die schwarz-weißen Videobilder, sagt Bruhns, hätten bei ihr den Impuls ausgelöst: Darüber will ich alles wissen! Warum sind die so geworden? Was war das für ein merkwürdiger Weg bis hin zu Freislers Richtertisch und dem Strick in Plötzensee?
Es hat mehr als zwei Jahrzehnte gedauert, ehe sie damit begann. Zuerst mussten zwei eigene Kinder großgezogen werden, die Journalistin ging für den „Stern“ nach Jerusalem und Washington. Eine kleine Legende schon zu dieser Zeit: Wibke Bruhns, inzwischen mit dem Namen ihres Mannes, die erste Frau, die im ZDF die „heute“-Sendung moderierte. Den Spagat zwischen Print- und elektronischen Medien hat sie durchgehalten. Gewann den Egon-Erwin-Kischpreis und wurde Kulturchefin beim Fernsehen des RBB. Schließlich Sprecherin der Expo in Hannover.
Ende der Brotberufe, nun war sie frei. Konnte Archäologin werden in den Trümmern des eigenen Stammes. Konnte Spuren suchen und graben. Sie hatte schon vorher gesammelt und die Verwandtschaft um Fundstücke gebeten. Nach dem Tod der Mutter ’87 barg sie Tagebücher und Briefe aus Schubladen. Nach der Wende meldete jemand aus Halberstadt, das Klamrothsche Familienarchiv liege auf dem Dachboden der Liebfrauenkirche, weiße Kladden in zwölf riesigen Buchattrappen. Bei der Stasi fanden sich Dokumente zum Namen Klamroth.
Wibke Bruhns hat den ganzen Berg an Material in ihre Berliner Wohnung geschafft. Zweieinhalb Jahre sichten, lesen, sortieren, schreiben. Eindringen in intime Sphären. Verblüfft entdecken, dass die Ehe der Eltern völlig zerrüttet war, als HG hingerichtet wurde. Der Vater ein Hallodri, der die Finger auch von jungen Hausmädchen nicht lassen konnte. Und immer war die Angst dabei, fürchterliche Verstrickungen zu finden, „Morde an der Zivilbevölkerung“ vielleicht.
Kommen Sie, ich zeige Ihnen… Sie wird das noch häufig sagen an diesem Tag. Ständig gibt es etwas zu zeigen. Im Fernsehzimmer das Video vom Volksgerichtshof. Im nächsten Raum das gerahmte Bild von Mutter Else, jung und pausbäckig. In der Abstellkammer hinter der Küche Regale mit Folianten, Protokollen, Fotoalben, die nicht benötigt wurden beim Versuch, „Geschichte zu beschreiben anhand von Menschen“.
Es ist ein Spaziergang durch eine geräumige Charlottenburger Maisonette, bei dem immer wieder die weitläufige Sippe der Klamroths grüßt. Antike Schränke, Teppiche, Miniaturen mit Portraits; die Kaffeemütze, mit der die Kanne warmgehalten wird, trägt die eingestickten Initialen der Großmutter. In jeder Ecke scheint es in Kästchen und Schatullen Depots für Zigaretten zu gehen.
Oben auf der Galerie ist ihr Arbeitsplatz. Ein gläserner Schreibtisch vor den breiten Terrassentüren, freier Blick auf den Himmel über Berlin. Links ein düsterer Schrank mit offenen Türen, holländisches Barock. Im Mittelteil lässt sich ein Geheimfach aufziehen, in dem die Mutter Familienschmuck aufbewahrte. In den Schrankfächern stehen 26 froschgrüne Plastikkästen für Hängeordner: Brautbriefe, Reisebeschreibungen HG 21-28, Gästebücher, Elterntagebücher… Aus den Dokumenten lappen hunderte von gelben Klebezetteln mit Bruhns’ Notizen.
Es kann nicht nur angenehm gewesen sein, so lange hier zu sitzen mit all den papierenen Gespenstern der Vergangenheit. Irgendwann hat Wibke Bruhns auch das Berichtsbuch des Klamrothschen Familienverbandes durchgesehen. Ins handschriftliche Protokoll ist auf Seite 63 der gedruckte § 9a geklebt, der Arier-Paragraph. Er soll sicherstellen, dass Mitglieder durch Ehen mit Nichtariern ausgeschlossen werden. Begründung des Vaters: „Wir sind mit Recht stolz auf diese Rassereinheit unsrer Sippe, die auch in Zukunft erhalten werden soll.“ Beglaubigt und abgestempelt am 17. 8. 1933 vom Amtsgericht Halberstadt. Erst zwei Jahre später wird der Rassenwahn der Nazis durch die Nürnberger Gesetz offiziell.
„Blankes Entsetzen“ habe sie bei diesem Fund gepackt – „ein Albtraum bis heute.“ Die Klamroths waren wer, ja. Halberstadt war reformiert, streng. Leitschnur waren Pflicht, Gottesfurcht, Tapferkeit. Wenn schon mitmachen, dann ganz vorne. „Ehre“, sagt Bruhns, „war wichtiger als Liebe.“
Es gab auch die Versuche zärtlicher, pathosgetränkter Gedichte. Eines vom Vater zum 20. Jahrestag der Verlobung. „Der Dank an Dich, daß Du mit mir gegangen / Mit mir, dem jungen, unerfahr’nen Mann / Der es gewagt, nach Deinem Stern zu langen…“ Oder die Liebe zu Hitler. Ende ’44 notierte die älteste Schwester: „So sehr gehöre ich dem an, der meinen Vater ermordet hat, daß noch kein klarer Gedanke gegen ihn aufzustehen gewagt hat.“
Es wurde viel geschrieben in dieser Familie. Von einem Ausflug verfasst jeder seinen Bericht, selbst die Haustöchter. Die Kinder bekamen einen Groschen pro Seite. Regelmäßig „Sonntagsbriefe“ mit Durchschlägen an alle. Für jeden Sprössling ein Tagebuch bis zur Konfirmation. Briefe aus dem Feld, ausführlich und anschaulich, wie im Kolportageroman: „Bei diesen Worten griff er zur Pistole mit derart angreifender Gebärde, daß ich mir darüber klar war, daß er sofort schießen würde, wenn er die Pistole auf mich anschlagen konnte. Deshalb schoß ich; da der erste Schuß vorbei ging und der Kerl darauf schrie: ,Du Hund, ich schieß dich tot!’ schoß ich sofort noch einmal. Da sank er um und blieb auch gleich still liegen.“
Schriftlich festgehalten wurden Gesprächsthemen von Abendgesellschaften und jede getrunkene Flasche Wein. Der Vater notierte von Autofahrten jeden Kilometer – und die Reisezeiten in Minuten; akribisch auch seine amourösen Abenteuer in gestochener Handschrift. Das Kriegstagebuch von Großvater Kurt ist kaum mit zwei Händen zu halten, eine in Leder gebundene Schwarte mit eingeprägtem Wappen, Inhaltsangabe mit Seitenzahlen.
Verständlich das Schwärmen der Autorin über den „gigantischen Stoff“ zu einem opulenten Familienreport. Doch die Annäherung an den eigenen Clan verläuft nicht ohne schmerzhafte Irritation. Warum verliert sich die Spur des Geschäftsfreundes Jacobsohn in den Aufzeichnungen, ohne jede Bemerkung über den Terror gegen Juden? Der Vater war verantwortlich für die Sicherheit von Hitlers Geheimwaffen V1 und V2, was wusste er über die Leiden der Fronarbeiter, über Vernichtungslager? Wie lesen sich die Zeilen der Mutter, die 1947 einem Kind ins Buch schrieb: „Ich sah voll Grauen auf die sinnlose Zerstörung und das Hinopfern des Volkes, nur weil ein Mann zu feige war einzugestehen, daß er gescheitert war.“ „Ein Mann?“, schreibt Tochter Wibke hinter diesen Satz. Sie kennt ja die früheren Briefe der Mutter: „Es geht ja wunderbar vorwärts – 80 km von Stalingrad entfernt! Sind wir dort, ist die Zange doch zu!“ Und bald auch noch „gehört uns das Mittelmeer!!!“
Neben dem Schreibtisch von Wibke Bruhns steht üppig ein knallbunter Strauß aus Seidenblumen. Inmitten der menschlichen und politischen Verirrungen sorgt er für Ermunterung. Auf den Tritten zur Terrasse liegen Reste der begleitenden Literatur, Sebastian Haffner, Norbert Elias, historische Fachbücher, Chroniken; im Regal nebenan stehen sie in Metern. Sie wollte durchs Lesen einfach verstehen, mit welchem Kompass durch die Klamrothschen Zeiten gesteuert wurde. Ehre? Satisfaktionsfähigkeit? Niemand heute würde daran sein Handeln messen. Der Eid auf Hitler, den bricht man eben, wenn nötig. So hat sie gedacht. Inzwischen, sagt sie, könne sie sehen, was das für einen Offizier bedeutete. Entschuldigen, nein, wolle sie damit nichts.
Ich kann mir den Mann nicht backen
Noch immer stehen am penibel aufgeräumten Arbeitspult zwei Fotos, die Verlobung der Eltern und der Vater, jung und traurig im Halbprofil. „Ich habe oft still mit ihnen geredet.“ Bisweilen muss es auch heftig zugegangen sein. Viele Sätze im Buch verraten Fassungslosigkeit und Empörung. „Kein Wort, nie, in all den Jahren nicht, über die Opfer.“ – „Was ist das für eine grenzenlose Hybris?“ – „Der spinnt.“ - „Mich empört der Ton hinterher, die aufgesetzte Verachtung…“ – „Ich kann mir den Mann nicht anders backen als er ist.“
Die Pflicht der Chronistin: hinschreiben, was ist. Selbst die grässlichen Dinge, die bösartigen. Gibt es da keine Skrupel? Sind Tagebücher und verzweifelte Liebesbriefe für fremde Leser bestimmt? „Grenzüberschreitend“ nennt die Tochter ihr Ausschlachten des Privaten. Und nötig. Weil der Vater nicht länger plakative Legende auf Ehrentafeln sein solle, sondern „dreidimensional“. Er habe getötet und Menschen gerettet, er war blinder Hurrapatriot und am Ende doch kein Denunziant, ein notorischer Lügner und Schürzenjäger.
Warum er schließlich das Attentat auf Hitler guthieß? Sie weiß es nicht genau, Hans Georg Klamroths Tagebücher wurden von der Gestapo mitgenommen. In Briefen gibt es nur wenige kryptische Andeutungen. Sie weiß eher, wie er starb. „Hängen wie Schlachtvieh“, wurde angeordnet, langsames Erdrosseln am Fleischerhaken.
Wibke Bruhns raucht, gießt Kaffee nach ins weiße Porzellan. Dort an der Decke, sagt sie, dieser sechsarmige Messingleuchter mit den Kerzen, der hing früher in Halberstadt. Er sei beim Bombenangriff runtergefallen und habe ihre Ostereier zerschlagen. Sie nimmt ihr Buch in die Hand, das erste gedruckte Exemplar. Das Titelfoto zeigt HG im Uniformmantel, an der Hand ein kleines, blondes Mädchen. Dieser nie vorhandene Vater, die stets angestrengte Mutter – das waren früher die Eltern für sie. Es könnte ja sein, dass die intensive Spurensuche Sympathie geweckt hat, Liebe.
Nein, sagt Wibke Bruhns.
* „Meines Vaters Land – Geschichte einer deutschen Familie“ von Wibke Bruhns erscheint am 16. 2., Econ, 390 Seiten, 22 €.
Tagesspiegel 15.02.2004
ZDF
Montag, den 17.11.2003
20.15 - 21.45
Der Fernsehfilm der Woche
Tod im Park
Thriller, Deutschland, 2003
Die Kriminalpsychologin Hannah Schwarz kommt nach Schwerin, um ihren kürzlich verstorbenen Vater Leo zu beerdigen. Ihr Widerwillen gegen die Stadt ist deutlich spürbar. Hier ist vor 40 Jahren ihre Familie kaputtgegangen, als sie als Siebenjährige kurz vor dem Mauerbau 1961 mit ihrer Mutter in den Westen ging. Vater Leo blieb in der DDR zurück. Zeit ihres Lebens hat die Mutter ihrem Mann Verrat und Treuebruch vorgeworfen, weil er sein Versprechen, der Familie in die Bundesrepublik zu folgen, nicht gehalten und als "hundertfünfzigprozentiger" Kommunist bei der Schweriner Polizei Karriere gemacht habe. Auf Grund der besonders engen Beziehung zur Mutter, die durch ihren Außenseiterstatus als DDR-Aussiedler noch verstärkt wurde, hat Hannah nie diese Legende über den Vater hinterfragt. Weder in ihrer Pubertät noch während ihres Psychologiestudiums oder bei ihren ersten beruflichen Schritten hat sie je Kontakt zum alten Schwarz gesucht. Nach der Wende unternahm der Vater zwar den ein oder anderen Versuch, in Kontakt mit Hannah zu treten, aber sie lehnte jedes längere Gespräch ab.
Der Krebstod der Mutter anderthalb Jahre zuvor traf Hannah tief und bestärkte sie zunächst sogar in ihrer Verachtung für den Vater. Erst in jüngster Zeit dachte sie daran, den Abtrünnigen für die verlorenen Jahre zur Rede zu stellen. Hannah begann sich ihre eigene persönliche Anklageschrift zurechtzulegen. Doch dann setzte der jähe Tod des Vaters all diesen Plänen ein Ende.
Während Hannah sich noch über ihre Emotionen klar zu werden sucht, lernt sie Suse Richter kennen, die langjährige Vertraute und Hausmeisterin ihres Vaters. Und sie begegnet einem Freund des alten Schwarz, dem Staatsanwalt Beus, der den Vater noch aus DDR-Tagen kennt und mit ihm zusammenarbeitete, noch bevor Leo Schwarz als politisch verdächtig ausgemustert wurde. Bei diesen Unterhaltungen erfährt sie, dass sich wenige Tage vor ihrer Ankunft in Schwerin ein mysteriöser Mordfall ereignet hat - und dass der Fall ihren Vater kurz vor seinem Tod offenbar in Aufruhr versetzte.
Immer mehr tauchen Erinnerungsbilder und Hinweise auf, die Hannah beunruhigen. Auf dem Schreibtisch ihres Vaters findet Hannah Zeitungsausschnitte, Suse Richter bestätigt, dass Leo Schwarz sich anders als sonst verhielt. Und schließlich erhält Hannah die Gewissheit, dass ihr Vater wegen des Falls sogar bei seinen ehemaligen Polizeikollegen vorstellig wurde, ohne dass er jemandem seine Gründe offenbarte. Freilich wurde seine Hilfe dankend abgelehnt - so wie nun auch Hannah freundlich, aber bestimmt vor die Tür gesetzt wird. Die Leiterin der Mordkommission Katharina Petrescu, die kurz nach der Wende 28-jährig nach Schwerin kam und senkrecht in der Polizeihierarchie aufstieg, ist nämlich der Meinung, dass ihr Team und sie der Lage durchaus allein gewachsen sind.
In dem Maße, in dem alte Gewissheiten über den Vater ins Wanken geraten, wächst auch Hannahs Unsicherheit. Im Nachlass findet sie alte Unterlagen, die belegen, dass es schon einmal zwei Frauenmorde in Schwerin gab, die fast bis aufs Haar der jüngsten Bluttat gleichen. Das war vor fast 25 Jahren. Und ihr Vater war damals offenbar mit den Ermittlungen befasst. Andererseits bringt Hannahs Nachfrage an den Tag, dass man bei der Polizei von einem solchen Fall nichts weiß. Ist es möglich, dass die Morde vertuscht wurden? Wenn ja, warum? Und: War ihr Vater nur in die Vertuschung verwickelt? Oder reicht seine Verstrickung in diesen Fall etwa noch weiter ...?
Hannah wird unbarmherzig mit ihrer persönlichen Vergangenheit konfrontiert, mit ihrer abrupt beendeten Schweriner Kindheit und den "schwarzen Löchern", die dieses Trauma in ihr Leben riss.
Länge: 90 min
Regie: Martin Eigler
Drehbuch: Sven Poser, Martin Eigler
Kamera: Wedigo von Schultzendorff
Musik: Wilhelm Stegmeier
Darsteller:
Hannah Schwarz - Barbara Rudnik
Konrad Fuchs - Harald Schrott
Katharina Petrescu - Meral Perin
Martin Beus - Dieter Mann
Suse Richter - Birke Bruck
Raik Schleusser - Thorsten Merten
Maria Helmer - Christina Grosse
Peter Armknecht - Hermann Beyer
Karl Benthin - Peter Kurth
http://www.heute.t-online.de/ZDFde/einzelsendung_content/0,1972,2197546,00.html
Zeitschrift "Für Sie"
erscheint am 7.10.2003 u.a. zum Thema Vatersuche. Erwachsene Frauen auf der Suche nach ihrem Vater.
„Die Vatersucherin“.
Ein ganz wunderbarer Artikel für und über Väter, die ihre Kinder nicht kennenlernen konnten, und über ihre Töchter: „Die Vatersucherin“.
http://www.taz.de/pt/2003/09/12/a0182.nf/text
Abenteuerliche Vater-Suche
Holde Barbara Ulrich:
Zuhause ist kein Ort
Ullstein Taschenbuchverlag, München 2000, 388 S.
Eine Rezension von Horst Wagner
Worin liegen die Wurzeln für ausländerfeindliche Gewalt? Das war angesichts der Anschläge von Düsseldorf, Eisenach und anderswo eines der zentralen Medien-Themen dieses 2000er Sommers. Dabei wurde auch die Frage diskutiert, ob die besonders erschreckenden Formen solcher Gewalt in Ostdeutschland vorwiegend auf die real-sozialistische Vergangenheit zurückzuführen sind oder ob sie nicht eher Westimporte sind, die im Osten angesichts eines radikalen Werteumbruchs und einer ungewohnten sozialen Unsicherheit auf besonders fruchtbaren Boden fielen. Vor diesem Hintergrund dürfte der Roman-Erstling der ostdeutschen Autorin Holde Barbara Ulrich, die bisher vor allem durch journalistische Reportagen, Porträts und Essays (erschienen von „Amica“ bis „Die Zeit“ sowie in Sammelbänden) bekannt geworden ist, auf besonderes Interesse stoßen. Zumal sie das Thema nicht trocken referierend angeht, sondern in eine spannende, in exotische Gefilde führende Story packt, wobei ihr sicher ihre Kenntnisse als studierte Philosophin und Afrika-Wissenschaftlerin zugute gekommen sind.
„Ich habe mir lange nicht erklären können, warum einige Leute mit den Fingern auf mich zeigen - mit höhnischer Neugier oder mit freundlichem Erstaunen ... Ich war einzigartig, immer auf dem Präsentierteller.“ So reflektiert Chioma, Tochter einer DDR-Deutschen und eines Nigerianers, der in Ostberlin studierte, aber noch vor Chiomas Geburt nach Afrika zurückkehrte, ihre Kindheit in einer ostdeutschen Kleinstadt. Später, in Berlin, wird sie von Skinheads angepöbelt und zusammengeschlagen und muß erleben, wie der Vorfall von Volkspolizei und Staatsanwaltschaft verharmlost und vertuscht wird. „Es bleibt das Entsetzen. Zum ersten Mal hat sie diese unglaubliche Mißachtung erlebt. Eine tödliche Bedrohung, gegen die sie nicht ankommt. Nur weil ihre Haut dunkler ist ...“
Clara, Chiomas Mutter, spricht aus enttäuschter Liebe nicht gern über Jonathan, den Vater. Für sie ist er gestorben. Und so sagt sie es auch ihrer Tochter: Dein Vater ist tot. Diese aber glaubt nicht daran. Kurz vor der „Wende“, im Sommer '89, macht sie sich auf, ihren Vater und ihre afrikanischen Wurzeln zu suchen. Da sie inzwischen afrikanische Literatur studiert, erwirkt sie eine Einladung ins DDR-freundliche Ghana, von wo sie auf abenteuerliche Weise, mehr oder weniger illegal, ins eher sozialismusfeindliche Nigeria gelangt. Von um sie werbenden Männern und hilfreichen Frauen unterstützt, findet sie dort ihren Vater. Aber er liegt im Sterben. Und Chioma muß feststellen, daß auch Nigeria für sie kein Zuhause ist.
So verkürzt wiedergegeben, scheint es eine etwas sentimentale Geschichte zu sein. Aber der Autorin ist vor allem eine sehr poetische, voller Lebensweisheiten steckende, tiefe Einblicke in afrikanische Gewohnheiten, Sitten, Gebräuche und Familientraditionen gebende Erzählung gelungen. Geschrieben in einer Sprache, die mal zupackend-direkt, dann wieder nachdenklich-retardierend ist und die den Leser das fremde Land gleichsam hören, schmecken und riechen läßt. Dahinter bleiben für meinen Geschmack allerdings die in der DDR spielenden Passagen merklich zurück. So verdienstvoll es ist, das Thema Ausländerfeindlichkeit in der untergegangenen Republik auch literarisch aufzugreifen (man fragt sich, warum das eigentlich nicht schon früher geschehen ist), so hätte doch dieser Widerspruch zwischen deklariertem Internationalismus in der Ideologie und tief im Alltagsbewußtsein steckenden Vorurteilen, zwischen durchaus praktizierter Solidarität und einem bis zu gewaltsamen Ausschreitungen reichenden Verdammen des „Fremdartigen“, dieses Hinwegsehen über erschreckende Vorgänge, weil sie nicht in das gewünschte Bild passen, eine tiefere und differenziertere Ausleuchtung verdient.
Aber vielleicht ist das schon das Thema für einen neuen Roman.
Zuhause ist kein Ort ist jedenfalls ein Buch, das sich mit einiger Spannung, vor allem aber mit Kenntnisgewinn und ästhetischem Genuß lesen läßt und dem man einen weiten Leserkreis wünschen kann.
http://www.luise-berlin.de/Lesezei/Blz00_12/text31.htm
Berliner LeseZeichen, Ausgabe 12/00 (c) Edition Luisenstadt, 2000
Vatersuche erfolgreich
Maradona trifft in Italien erstmals seinen Sohn - Sprössling ist 17 Jahre alt
21.5.2003
Auf einem Golfplatz in Italien hat der ehemalige argentinische Fußballstar Diego Maradona zum ersten Mal seinen fast volljährigen Sohn Diego Armado junior getroffen. Wie die italienische Zeitung "Il Mattino" berichtete, verschaffte sich der 17-Jährige unter einem Vorwand Zutritt zu dem Gelände und näherte sich dann seinem Vater, der ihn zunächst für einen Autogrammjäger hielt. Als der 42-jährige Maradona mit einem Buggy fliehen wollte, gab sich sein Sohn zu erkennen. Nach einer Umarmung unterhielten sich Diego junior und Diego senior dann lange auf dem Golfplatz in Fiuggi 80 Kilometer östlich von Rom.
Diego Armados Mutter ist Christiana Sinagra, die mit Maradona liiert war, als dieser in den 80er Jahren in Neapel spielte. Maradona hat außerdem zwei Töchter aus der Ehe mit Claudia Villafane, die nach 14 Jahren Ehe im März die Scheidung eingereicht hatte. Seine Frau fordert das Sorgerecht für die beiden Töchter Dalma und Giannina.
www.meta-spinner.de/newsContent/panorama/030521070344.ikhhjov6.shtml
Vatersuche
SPIEGEL ONLINE - 29. April 2003, 13:07
Ahnenforschung
Susan Stahnke, uneheliche Tochter eines Milliardärs?
Zurzeit vaterlos:
Susan Stahnke
Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Susan Stahnke ist auf der Suche nach ihrem wahren Vater. Nach einem Zeitungsbericht könnte der gesuchte Papa ein steinreicher Geschäftsmann sein. Als Beweis sollen Wissenschaftler schon ein Gesichtsgutachten erstellt haben.
Hamburg - Es gebe Hinweise darauf, dass "ihr wahrer Vater ein Geschäftsmann ist, dessen Familienvermögen auf eine Milliarde Euro geschätzt wird", schreibt die "Bild"-Zeitung. Gerüchten zufolge habe der Mann drei Monate vor der Hochzeit von Stahnkes Eltern ein Verhältnis zur Mutter der früheren "Tagesschau"-Sprecherin gehabt haben, schreibt das Blatt.
Ein Vaterschaftstest soll nun die Herkunft von Susan Stahnke klären. Angeblich haben Wissenschaftler bereits ein Gesichtsgutachten erstellt. Die Ähnlichkeit sei verblüffend, vieles spreche für die Vaterschaft des Geschäftsmannes.
Seit Monaten sei die 37-jährige Susan Stahnke nun auf der Suche nach ihrem richtigen Vater, schreibt "Bild". Vor fünf Monaten habe Bernhard Stahnke, den sie jahrelang für ihren Vater gehalten habe, ihr mitgeteilt, dass er nicht ihr leiblicher Vater sei. Vor wenigen Tagen habe nun ein Hamburger Familiengericht Bernhard Stahnke die Vaterschaft aberkannt. Zur neuesten Entwicklung sagte Susan Stahnke nur: "Wenn das alles stimmen sollte, würde mir im Nachhinein einiges klar."
29.04.2003
www.spiegel.de/panorama/0,1518,246669,00.html
"Papa, bist du ein Fremder?"
Ulrike Kuckero lässt eine Elfjährige ihren Vater suchen
An einem Samstagmorgen sitzt die elfjährige Hanna in ihrem Zimmer inmitten von Kartons, die ihre Mutter wegen einer Renovierung vorübergehend in ihrem Zimmer abgestellt hat und ist wütend über die Enge und das fremde Chaos. Sie weiß noch gar nichts davon, dass sie schon bald ihren Vater suchen wird. Ulrike Kuckero erzählt diese Geschichte und von denen, die Hanna bei dieser Suche helfen. Mit ihrer Freundin Merle kann sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lebensformen schnell vergleichen. Merle lebt in einer Familie, ihren kleinen Bruder Matti findet sie viel schlimmer als Kartons im Zimmer. Hanna lebt mit ihrer Mutter allein.
Beim Verkauf alter Sachen auf dem Flohmarkt fällt Hanna ein Briefumschlag aus lzmir in die Hände, der muss von ihrem Vater sein, und sie erinnert sich an ihre Gedanken, Wünsche und Phantasien. Der alte Briefumschlag lässt ihr die Tränen hochsteigen und gemeinsam mit der pragmatischen Merle kommt es zu dem Entschluss, den Vater zu finden. Dabei gehen die beiden ganz systematisch vor, ohne die Mutter einzuweihen.
Einem türkischen Vater schreibt man türkisch, Songül, die türkische Klassenkameradin übersetzt und der Brief geht nach lzmir.
"Willkommen im Club" begrüßt Hanna eines Tages ihren Schulfreund Peter, dessen Eltern sich getrennt haben und der am Wochenende nie Zeit hat, weil er immer seinen Vater besuchen soll, der seine Kartons in der neuen Wohnung überhaupt nicht auspackt. Songül lernen die anderen Kinder bei diesem Briefprojekt besser kennen, besuchen sie zu Hause und erfahren von ihr, wie man türkischen Tee zubereitet oder die wichtigsten Wörter der türkischen Sprache ausspricht.
Den Weg des Briefes verfolgt die Autorin aus ihrer Erzählerperspektive, so wissen die Leser immer mehr als Hanna. Ulrike Kuckero erzählt sehr nah an der Gefühlslage ihrer Hauptfigur von den tiefen Emotionen, die die Frage nach dem Vater, nach dem eigenen Gewünschtsein hervorrufen. Ganz nebenbei ist einiges zu erfahren über eine andere Kultur und das Leben eines türkischen Mädchens in Deutschland. Eine intensive, spannend erzählte Geschichte.
BEATE SIMON
in: "Der Tagesspiegel", 3./4.6.2001
Ulrike Kuckero: Ein Brief an Ali. Die Geschichte von Hanna, die ihren Vater sucht. Thiemann Verlag, Stuttgart 2000. 160 Seiten, 19,80 DM.
Missing Link
Auf der Suche nach dem verschollenen Vater
Zeitgeschichtlicher Film, Niederlande, 1998
Nachfolgend eine Kurzfassung des Filmes, in dem wir die spannenden Stellen gestrichen haben und an diesen Stellen mit ... markiert haben. Wenn Sie sich den Film noch anschauen wollen, lesen sie nur unserer erste Textfassung durch. Wollen Sie dagegen gleich wissen, worum es in dem Film geht, lesen Sie unsere darunter stehende zweite ausführliche Textfassung.
1955 ist Rick elf Jahre alt. Zusammen mit seiner Mutter Lydia und seiner Tante Wally lebt er in einer niederländischen Kleinstadt. Sein Vater war im Zweiten Weltkrieg Pilot bei der britischen Royal Air Force, er wurde abgeschossen, und Rick hat ihn nicht mehr kennen gelernt.
Ricks Mutter hat einen festen Freund, Jef. Der ist Tabakwarenhändler, eigentlich sehr nett, aber auch ein ziemlicher Prahlhans. Rick findet, dass er es mit seinem Vater, der schließlich ein wahrer Held gewesen ist, nicht aufnehmen, geschweige denn ihn ersetzen kann.
Eines Tages bekommt Rick in der Schule einen Film über eine Dschungel-Expedition durch den Kongo zu sehen. Von nun an lässt das "Herz der Finsternis" den Jungen nicht mehr los. Und weil ihn alles, was mit dem "Schwarzen Kontinent" zusammenhängt, brennend interessiert, schenkt ihm seine Mutter einen alten Atlas. In dem findet Rick einen genealogischen Stammbaum der Menschheit, in den der Vorbesitzer an der Stelle des Übergangs vom Affen zum Menschen mit einem Füller die Worte "Missing Link" eingetragen hat. Als Rick wenig später in der Zeitung liest, dass in Kürze eine Expedition aus Brüssel in den Kongo aufbrechen wird, um nach diesem "Missing Link" zu forschen, versucht er deren Leiter, Professor Oudeweetering, zu erreichen. Denn Rick, der inzwischen einen ganzen Stapel Bücher über Afrika gelesen hat, ist überzeugt, dass die Expedition am falschen Ort sucht. Und weil er den Professor nicht ans Telefon bekommt, macht er sich - nach einer heftigen Auseinandersetzung mit seiner Mutter über Jef - selbst auf den Weg nach Brüssel, um den Forscher über seinen Irrtum aufzuklären. Als "Reiselektüre" hat er sich ein altes Tagebuch seiner Mutter stibitzt, und als er nun darin blättert, bricht für ihn eine Welt zusammen: ...
Unterdessen hat Lydia bemerkt, dass sowohl ihr Sohn als auch das Tagebuch verschwunden sind. Natürlich kann sie zwei und zwei zusammenzählen -unverzüglich ruft sie Professor Oudeweetering an. Das fällt ihr nicht gerade leicht, denn sie muss dem Wissenschaftler nicht nur berichten, dass Rick auf dem Weg zu ihm ist, sondern auch ... .
Länge: 90 min
Regie: Ger Poppelaars
Drehbuch: Timo Veltkamp
Darsteller:
Lydia Veenema - Tamar van den Dop
Oudeweetering - Johan Leysen
Rick Veenema - Nick van Buiten
Jef - Thomas Acda
Stella Allofs - Lotte van der Laan
Die Ausführliche Textfassung
Bitte nicht lesen, wenn Sie sich noch vom Film überraschen lassen wollen.
Missing Link
Auf der Suche nach dem verschollenen Vater
Zeitgeschichtlicher Film, Niederlande, 1998
1955 ist Rick elf Jahre alt. Zusammen mit seiner Mutter Lydia und seiner Tante Wally lebt er in einer niederländischen Kleinstadt. Sein Vater war im Zweiten Weltkrieg Pilot bei der britischen Royal Air Force, er wurde abgeschossen, und Rick hat ihn nicht mehr kennen gelernt.
Ricks Mutter hat einen festen Freund, Jef. Der ist Tabakwarenhändler, eigentlich sehr nett, aber auch ein ziemlicher Prahlhans. Rick findet, dass er es mit seinem Vater, der schließlich ein wahrer Held gewesen ist, nicht aufnehmen, geschweige denn ihn ersetzen kann.
Eines Tages bekommt Rick in der Schule einen Film über eine Dschungel-Expedition durch den Kongo zu sehen. Von nun an lässt das "Herz der Finsternis" den Jungen nicht mehr los. Und weil ihn alles, was mit dem "Schwarzen Kontinent" zusammenhängt, brennend interessiert, schenkt ihm seine Mutter einen alten Atlas, der seinem Vater gehört hat. Das einzige, so die Mutter, was sie von ihm noch hat. In dem Atlas findet Rick einen genealogischen Stammbaum der Menschheit, in den der Vorbesitzer an der Stelle des Übergangs vom Affen zum Menschen mit einem Füller die Worte "Missing Link" eingetragen hat. Als Rick wenig später in der Zeitung liest, dass in Kürze eine Expedition aus Brüssel in den Kongo aufbrechen wird, um nach diesem "Missing Link" zu forschen, versucht er deren Leiter, Professor Oudeweetering, zu erreichen. Denn Rick, der inzwischen einen ganzen Stapel Bücher über Afrika gelesen hat, ist überzeugt, dass die Expedition am falschen Ort sucht. Und weil er den Professor nicht ans Telefon bekommt, macht er sich - nach einer heftigen Auseinandersetzung mit seiner Mutter über Jef - selbst auf den Weg nach Brüssel, um den Forscher über seinen Irrtum aufzuklären. Als "Reiselektüre" hat er sich ein altes Tagebuch seiner Mutter stibitzt, und als er nun darin blättert, bricht für ihn eine Welt zusammen: Sein Vater war gar kein Pilot, sondern ein verheirateter Mann!
Unterdessen hat Lydia bemerkt, dass sowohl ihr Sohn als auch das Tagebuch verschwunden sind. Natürlich kann sie zwei und zwei zusammenzählen -unverzüglich ruft sie Professor Oudeweetering an. Das fällt ihr nicht gerade leicht, denn sie muss dem Wissenschaftler nicht nur berichten, dass Rick auf dem Weg zu ihm ist, sondern auch offenbaren, dass er dessen Vater ist.
Länge: 90 min
Regie: Ger Poppelaars
Drehbuch: Timo Veltkamp
Darsteller:
Lydia Veenema - Tamar van den Dop
Oudeweetering - Johan Leysen
Rick Veenema - Nick van Buiten
Jef - Thomas Acda
Stella Allofs - Lotte van der Laan
"Möwenschwingen. Auf der Suche nach dem verlorenen Vater."
von Jonathan Bach Preis: DM 16,90
Taschenbuch - 379 Seiten - Ullstein TB-Vlg., B.
Erscheinungsdatum: 1997
ISBN: 3548241239
Rezension:
Ich habe soeben im Urlaub einen faszinierenden autobiographischen Roman gelesen, den ich euch sehr empfehlen möchte. Er stammt von dem amerikanischen Jung- Schriftsteller Jonathan Bach, dem Sohn von Richard Bach, dem Autor des ebenfalls unbedingt lesenswerten Buches "Die Möwe Jonathan", das von der Freiheit des Individuums erzählt und eine tiefe philosophische Ebene hat.
Jonathan Bach, selbst benannt nach dem Bucherfolg seines Vaters, erzählt die Geschichte seines eigenen Lebens als Scheidungskind, dem in seiner Kindheit dem Vater entfremdet wird. Detailreich schildert der Autor die eigene Verbitterung gegen den sich vermeintlich abwendendenden Vater, die dem Erzähler durch die subtile Einflussnahme seiner Mutter eingeimpft wird und die schließlich fast bis zur endgültigen Ablehnung des Vaters führt. Behutsam keimt zuerst ein zaghafter Briefkontakt auf, der zwischenzeitlich jahrelang stagniert, aber immer wieder aus Sehnsucht und dem Willen zur Auseinandersetzung mit dem angeblichen Drückeberger neu aufgenommen wird.
Nach dieser jahrelangen und oft unbewußten Suche, trotz aller Widrigkeiten und sich aufbauender Vorbehalte findet Jonathan schließlich auf seine Art seinen eigenen Weg zu seinem Vater, zu dem er trotz aller Distanz eine verblüffende Seelenverwandtschaft hat. Am Schluß steht ein Vater-Sohn Verhältnis, wie es intensiver wohl nicht sein könnte.
Faszinierend ist das Buch zunächst, weil es packend geschrieben und brilliant geschildert ist, frei von vordergründigen Schuldzuweisungen und eindimensionalen Erklärungsmustern. Die Wahrnehmungen Gefühle des sich entwickelnden Jungen stehen immer im Vordergrund, und so ist auch der Leser geneigt, hin und wieder für oder gegen den einen oder anderen Elternteil Partei zu ergreifen, um auch sein eigenes Urteil immer und immer wieder revidieren und in einem anderen Licht betrachten zu müssen.
Die Entwicklung des Vater- Sohn- Verhältnisses durchläuft verschiedene Stadien, vom zur Märchenfigur verklärten "Captain" über den distanziert-kumpelhaften "Richard" bis hin zum vertrauten "Dad", den der kleine Junge Jon immer mit den klischeehaftesten Bildern verbunden hatte und aus dritter Hand kannte und den schließlich junge Mann, studierte Journalist und werdende Schriftsteller Jonathan Bach mit 22 Jahren erleben darf.
"Möwenschwingen" vermittelt wie beiläufig allerhand authentische Einblicke in Wege der Elternentfremdung resultierend zunächst aus dem blinden Kampf einer verbitterten Frau gegen den Vater ihrer Kinder. Es zeigt aber auch, dass ein bedingungsloses Aufrechterhalten einer nicht mehr lebensfähigen Paarbeziehung ebenso (selbst-) zerstörerische Folgen haben würde.
Am Ende steht die philosophisch anmutende Erkenntnis, dass jeder Mensch sein Schicksal selbst gestaltet und bis zu einem gewissen Grad sogar unbewußt selbst wählt. Es bleibt keine Verbitterung über die entgangenen Jahre der Kindheit, weil gerade dieser Weg letztendlich zu einer so tiefen und erkenntnisreichen Vater- Sohn-Beziehung geführt hat.
Hier schließt sich der Kreis zur Philosophie der Bücher von Richard Bach.
Ganz nebenbei habe ich innerhalb von zwei Stunden während der Lektüre des Romans meiner 6 jährigen Tochter die "Möwe Jonathan" vorgelesen, die ebenso gebannt an meinen Lippen hing wie ich selbst beim Lesen war, der ich das Buch nach über zehn Jahren wieder gelesen hat.
Ganz nebenbei ist "Möwenschwingen" wie natürlich schon die "Möwe Jonathan" auch ein Buch über die Freiheit, die das Fliegen vermittelt und veranschaulicht. Beide Eltern von Jonathan sind begeisterte Flieger. So schließlich wird auch die Widmung im Buchdeckel mehr als verständlich:
"Für Mom und Dad, die mir gemeinsam Flügel gaben und mich getrennt das Fliegen lehrten."
Gerd Vathauer, 12.07.01
Wiedersehen nach 22 Jahre
"Nach 22 Jahren hat die Britin Gemma Dudas ihren Vater über das Internet wieder gefunden. Andy Drumm hatte sich kurz nach Gemmas Geburt von deren Mutter getrennt und jeden Kontakt verloren. die hartnäckigen Bemühungen der Tochter, ihren Vater zu finden, hatten zu Weihnachten Erfolg. Über die Such-Webseite `Friends Reunited` stieß Gemma auf einen gewissen Andrew Drumm und hatte ihren Vater in Washington am Rohr."
Tiroler Tageszeitung, 27.12.02
Montag, 6. Mai 2002
***
WDR, 22.30 - 23.15 Uhr (45 Minuten):
Die story - Wer ist mein Vater?
Menschen auf der Suche nach einem unbekannten Samenspender
Ehemaliger Seemann aus Schweden und seine Tochter in Lübeck fanden sich wieder
Familienglück nach 31 Jahren
Seine Ehe in Lübeck scheiterte. Also fuhr der schwedische Seemann Gunnar Thorbjorn Kihlstrom wieder zur See. Ohne Kontakt zu seiner Tochter Andrea, die bei der Mutter in der Hansestadt bleib. 31 Jahre vergingen, ehe sich die beiden wiederfanden. Zu groß war die Furcht des Vaters, seine Tochter wolle vielleicht gar nichts mehr von ihm wissen.
Jetzt gab es ein Wiedersehen in Schweden und beide schmieden bereits gemeinsame Pläne.
Gunnar Thorbjorn Kihlstrom ist überglücklich. Der ehemalige Seemann aus Bjoretorp - ein kleines Dorf rund 30 Kilometer südöstlich von Göteborg - hat nach 31 Jarhen Trennung seine Tochter Andrea Greiber in Lübeck wiedergefunden. Der erste Kontakt zu der 34jährigen kam überraschend exakt an Thorbjorns 60. Geburtstag. Jetzt sind sich Vater und Tochter zum ersten Mal nach drei Jahrzehnten wieder begegnet - an einem Fähranleger in Schweden.
Andrea war eben drei Jahre alt, als Thorbjorn Kihlstrom das Mädchen und seine Mutter verließ und zur See fuhr. Seine Frau und Andrea blieben allein in ihrer Wohnung in Lübeck zurück. Die Eltern hatten jung geheiratet, doch die Ehe scheiterte. Nach der Scheidung fuhr Thorbjorn auf vielen Schiffen die Weltmeere und landete schließlich - viele Jahre später - in seiner Heimatstadt Göteborg.
Andrea blieb bei ihrer Mutter in Lübeck. Sie hatte sich oft gefragt, wo ihr Vater jetzt wohl sein mochte. Aber jedes Mal, wenn sie fragte, bekam sie den guten Rat, es nicht zu versuchen, nach ihm zu suchen. Das Argument: "Er ist Seemann! Du findest ihn niemals!"
Jahrzehnte später hat dann Kihlstrom auf verschiedenen Wegen die Suche nach seiner Tochter aufgenommen. Doch erst sein letzter Versuch war ein Volltreffer:
...
ausführlich in: "Lübecker Nachrichten", 1997
Und wenn sie nicht gestorben sind - dann leiden sie noch heute
Klaus (Name frei erfunden) ist ein Scheidungskind. 1975, als sich seine Eltern trennten, war er 6 Jahre alt. Heute im Jahr 2002 ist er 33 Jahre alt. Klaus hat nicht geheiratet, den jahrelangen Stress, den er damals zwischen seinen Eltern erleben musste, wollte er nie haben. Das Sorgerecht wurde seinem Vater gleich bei der Scheidung entzogen. Das war damals so üblich, hat Klaus inzwischen erfahren. Mutti hat dann wieder ihren Mädchennamen angenommen.
Als Klaus 8 Jahre war, hat er von sich aus den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen. Sein Vater, Herr Rastlos, soll nicht ganz richtig im Kopf gewesen sein, sagte seine Mutter und Unterhalt hat er auch kaum welchen bezahlt. Die Entscheidung zum Kontaktabbruch hat Klaus ganz allein getroffen. Seine Mutter hat immer gesagt, "Du kannst ruhig zu deinen Vater gehen." und dabei hat sie immer ganz traurig geguckt. Da hat Klaus gleich gewusst, er muss zu seiner Mutter stehen, sie braucht ihn. Sie hat ja auch immer zu ihm gesagt, "wenn ich dich nicht hätte, dann hätte ich mir schon lange das Leben genommen". Wie gesagt, es war die freie Entscheidung von Klaus. Nach der Entscheidung von Klaus soll sein Vater mit Mutti vor dem Gericht noch drei Jahre um das Umgangsrecht gestritten haben. Zum Schluß hat der Richter das Umgangsrecht auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Das Kind soll endlich zur Ruhe kommen, außerdem will der Junge ja nicht seinen Vater sehen, das ist doch offensichtlich, meinte der Richter. Die Frau vom Jugendamt hat das auch so gesehen. Auch der Gutachter Dr. Wichtigtu hat das in seinem 10-seitigen Gutachten festgestellt. Und Mutti sowieso, nach all dem was ihr Herr Rastlos angetan hat. Klaus ist dann tatsächlich zur Ruhe gekommen, das wichtigste war, dass Mutti immer bei ihm war.
Der Scheidungsrichter von damals soll nun inzwischen schon über 70 Jahre sein. Er wohnt immer noch in dem gut gepflegten Vorort von S., dort wo halt die "besseren" Leute wohnen. Richter sind halt feine Leute. Dort wohnt auch immer noch der Scheidungsanwalt, den die Mutter von Klaus damals hatte. Der Anwalt hatte Biß, sagten die Leute in S. Inzwischen ist der Anwalt schon 80 Jahre und wahrscheinlich hat er inzwischen ein komplettes drittes Gebiß. Als Anwalt hat er schon mit 60 Jahren aufgehört zu arbeiten. Er ist dann in Immobilien tätig gewesen, da konnte man wesentlich mehr verdienen als mit den Scheidungssachen und den Mandanten, die immer meinten, für wenig Geld so eine Art anwaltliche Rundumversorgung zu erhalten. Die haben ja gar keine Ahnung, was so eine Rechtsanwaltskanzlei kostet. Leicht hatte es der ehemalige Anwalt auch nicht. Seine Tochter hat sich mit 40 das Leben genommen. In der Stadt munkelte man so allerlei, der Anwalt soll seine eigene Tochter schwer getriezt haben, dass hat sie dann irgendwie nicht mehr ausgehalten. Na ja, was die Leute so reden, wahrscheinlich sind sie nur neidig auf sein Geld und das schöne Haus vom Anwalt und dass ihnen selber der Biß fehlt.
Mit 14 ist Klaus dann in der Schule auffällig geworden. Er hat immer andere Mitschüler angegriffen. Die Lehrer in der Schule waren plötzlich alle gegen ihn. Die einzige, die zu ihm gehalten hat war Mutti. Sie ist dann auch mit Klaus zum Psychiater gegangen, wegen der nervösen Unruhe. Der Psychiater hat dann dem Klaus Ritalin verschrieben, das hilft gegen Hyperaktivität, hat der Psychiater gesagt. Klaus ging es dann wirklich viel besser. Die Welt wirkte zwar etwas verschwommen, aber das war nicht so schlimm, Hauptsache Mutti war immer in der Nähe von Klaus.
Herr Rastlos, der Vater von Klaus ist dann 1995 gestorben, die Leute sagten, er hätte sich totgesoffen. Zur Beerdigung ist Klaus nicht gegangen, was sollte er auch dort, er hat ja seinen Vater 18 Jahre nicht gesehen. Außerdem ist er zu der Zeit mit Mutti in den Schwarzwald gefahren. Mutti musste wegen ihrer Migräne zur Kur.
Wie gesagt, Klaus hat wegen dem ganzen Scheidungsärger nicht geheiratet. Als ihm Andrea, eine Bekannte die er nur kurz kannte, sagte, dass sie ein Kind von ihm erwarte, da ist er echt aus allen Wolken gefallen. Sie hat gesagt, sie nimmt die Pille. Und er hatte ihr doch ganz klar gesagt, dass er kein Kind will. Kinder nerven ihn bis heute, er weiß auch nicht warum, aber es ist so. Das war echt hart. Sie wollte nicht abtreiben und hat das Kind ausgetragen. Da ist für Klaus eine Welt zusammengebrochen. Mutti konnte ihm auch nicht helfen, sie war selber wegen psychosomatischer Beschwerden wieder in einer Kurklinik.
Klaus hat dann wochenlang Depressionen gehabt. Dann kam auch noch so ein Brief vom Jugendamt, Klaus solle sich wegen der Vaterschaftsanerkennung im Jugendamt melden und auch gleich noch den Kindesunterhalt beurkunden lassen. Klaus hat sich dann erst mal nicht dort gemeldet. Die Post im Briefkasten hat er einfach nicht mehr rausgenommen. Dann kam ein Einschreiben Da stand drin, dass gegen ihn eine Vaterschaftsklage erhoben wurde. Klaus ist da einfach nicht zum Termin gegangen. Vier Wochen später stand die Polizei bei ihm vor der Tür. Er solle sich umgehend bei der Polizeidienststelle melden, es liege eine Strafanzeige der Kindesmutter vor, wegen Verletzung der Unterhaltspflicht.
Klaus wird nun seit drei Jahren psychiatrisch behandelt. Er kriegt starke Beruhigungsmittel, die helfen ihm, sagt ihm sein Psychiater, den er schon aus seiner Schulzeit kennt. Klaus soll unter Schizophrenie leiden, die ist unheilbar, hat der Psychiater in seinem Gutachten für das Gericht geschrieben. Seitdem hat auch das Jugendamt locker gelassen, mit Schizophrenie ist eben nicht zu spaßen. Manchmal besucht Klaus seine Mutti noch. Mutti lebt jetzt im Pflegeheim in S. Auf dem Rückweg von Mutti zu seiner kleinen Wohnung vom "Betreuten Wohnen" kommt Klaus immer am Friedhof vorbei. Dort liegt sein Vater begraben. Klaus geht dann immer schnell daran vorbei. Wer weiß, vielleicht sehen sie sich doch mal, irgendwann, dort auf der anderen Seite, von der es keine Rückkehr geben soll.
Anton, 2.4.2002
Willy Brandt
"Willy Brandt kam als Herbert Ernst Karl Frahm am 18. Dezember 1913 in Lübeck zur Welt. Lübeck war eine traditionsbewußte Hansestadt, deren Bürger über Jahrhunderte weltweite Handelsbeziehungen geknüpft und es so zu Wohlstand gebracht hatten. Thomas Mann setzte ihrem gelassenen Selbstbewußtsein in seinen ´Buddenbrooks´ ein bleibendes Denkmal. Ausgezeichnete Schulen und ein reges kulturelles Angebot waren eine Selbstverständlichkeit für Lübeck, und der junge Brandt wurde durch beides später stark geprägt. Wie in allen Städten gab es allerdings auch in Lübeck eine ökonomisch schwache Arbeiterklasse mit eigener Kultur und ausgeprägten Traditionen. Bürger- und Arbeiterschicht hatten kaum Berührungspunkte.
Brandt war der illegitime Sohn einer neunzehnjährigen Verkäuferin im Konsumverein. Durch seine Herkunft gehörte er somit zum ´anderen´, dem armen Deutschland. Seine Mutter lebte in einer winzigen Einzimmerwohnung, und da sie weiter arbeiten mußte, blieb der Sohn oft in der Obhut von einer Nachbarin oder beschäftigte sich allein. Brandt erinnerte sich an viele einsame Stunden ohne Spielkameraden. Als er fünf Jahre alt war, kam sein Großvater aus dem Ersten Weltkrieg zurück - er roch nach Schweiß, nassem Leder, Puder und Öl, wie sich Brandt noch später erinnerte. Das faszinierte den bisher nur von Frauen umgebenen Jungen. Er entwickelte eine starke Anhänglichkeit an diesen Mann, von dem sich später herausstellte, daß er noch nicht einmal Brandts richtiger Großvater war. Als der Witwer 1919 wieder heiratete, zeigte Brandt heftige und unversöhnliche Eifersucht. Gleichwohl lebte er weiter bei ihnen. Seine Mutter, eine lebensfreudige junge Frau, kümmerte sich nicht sonderlich um ihr Kind. Er sah sie vielleicht zweimal in der Woche. Doch zeigen ihn Bilder aus seiner frühen Kindheit in hübschen Uniformen oder im Matrosenanzug.
Brandt war ein hochintelligenter Junge, der leidenschaftlich gern las und mit der kleinen Büchersammlung seines Großvaters aufwuchs. In ihr befanden sich die Standardwerke der aufstrebenden, bildungs-beflissenen Arbeiter der damaligen Zeit wie die Werke von Karl Marx oder auch Bebels ´Frauen und Sexualität´. Der Großvater hatte auf seine Art Karriere gemacht. Vom Leibeigenen auf einem Gut in Mecklenburg stahl er sich nach Lübeck davon und arbeitete sich dort vom Fabrikarbeiter zum Lastwagenfahrer empor. Auch Brandts Mutter bemühte sich, Hochdeutsch zu sprechen. Sie las viel - Bücher ließen sich leicht aus der Konsumbücherei besorgen - , war auch aktives Mitglied einer Laienschauspielgruppe und hatte ein Abonnement für die Volksbühne, an der die großen Klassiker aufgeführt wurden. Sie konnte ganze Passagen aus Schillers Werken auswendig. Brandt wuchs somit in einer Atmosphäre auf, in der Lernen und An-sich-Arbeiten Teil des Alltags waren.
Über seinen Vater wurde nie gesprochen. Erst nach dem Krieg wagte Brandt selber, Nachforschungen anzustellen. Er soll ein gewisser Jens Möller aus Hamburg gewesen sein, ein 1958 verstorbener Buchhalter. Er hatte nie Interesse an seinem Sohn gezeigt. Möller hing der Ruf eines begabten Eigenbrötlers an, der eigentlich hatte Lehrer werden wollen."
aus "Willy Brandt", S. 1-2, Barbara Marshall, 1993, ISBN 3-416-02436-2
"Landschaft im Nebel"
Kinofilm, 120 min
Regisseur Theo Angelopoulos, Griechenland 1988
Der Film beschreibt die Suche der elfjährigen Voula und ihres fünfjährigen Bruders nach ihrem Vater - eine Reise voller Begegnungen und Enttäuschungen, die die beiden zur Entdeckung der Welt führt.
DRK Suchdienst
Aufgaben des Suchdienstes
Zusammenführung von Menschen, die durch folgende Ereignisse getrennt wurden:
Kriege/bewaffnete Konflikte
Trennungsfälle des 2. Weltkrieges
Trennungsfälle durch aktuelle Konflikte weltweit
Katastrophen
Naturkatastrophen
Technische Katastrophen
Sonstige Trennungsfälle verursacht weder durch Kriege noch durch Katastrophen;
die Suchanfrage wird aus humanitären Gründen (Alter, Krankheit, Hilflosigkeit) akzeptiert
Suche nach dem Vater
Nach den Funden von zwei toten Babys mit der selben unbekannten Mutter will die Flensburger Polizei nun die DNA des Vaters abgleichen. Hatten die Kinder auch den selben Erzeuger? (13.03.2007, 14:29 Uhr)
Flensburg - Nach der Mutter werde derweil weiter gesucht, sagte Kripo-Sprecher Sönke Büschenfeld. Anfang März hatte ein Autofahrer an einem Parkplatz einen toten Jungen in einer Plastiktüte entdeckt. Vor einem Jahr hatten Arbeiter in einer Müllsortieranlage die Leiche eines neugeborenen Mädchens im Altpapier gefunden. Die Fundorte der Leichen liegen 25 Kilometer voneinander entfernt.
Einem Gutachten zufolge wurden die Säuglinge von der selben Frau geboren. Beide waren lebend zur Welt gekommen. Klar scheint jetzt auch zu sein: Der Junge wurde vorsätzlich getötet. Bei dem Mädchen war das nicht mehr feststellbar. Polizei und Staatsanwaltschaft setzen auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Ermittler erwägen auch einen Reihen-Gentest unter Frauen im gebärfähigen
Alter. Jedoch seien die Hürden zu einer solchen Maßnahme sehr hoch gesetzt,
erläuterte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ulrike Stahlmann-Liebelt.
Laut Gesetz müsse der Personenkreis sehr klar definiert sein, etwa nach
Geschlecht, Alter und Wohnort. (tso/dpa)
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/nachrichten/tote-babys-sachsen-anhalt-vater/95626.asp
Salmonberries
D 1991, 91min, Regie: Percy Adlon, mit Rosel Zech, k.d. lang, Oscar Kawagley, Eugene Omiak, Jane Lind...
Sie wurde als Neugeborenes in der Schneetundra gefunden. In einer Pappschachtel. Jetzt ist sie zwanzig. Sieht aus wie ein junger Mann. Sie kennt weder Vater noch Mutter. Sie will wissen, wer sie ist. Als sie die Tür zur Stadtbibliothek öffnet, schaut sie in das helle Gesicht einer Frau. Die Zeit steht still. Von nun an versucht sie alles, um Roswitha, die Bibliothekarin aus Berlin, für sich zu gewinnen. Eine Eskimosiedlung im Nordwesten Alaskas. Eine heiße Liebe in einem kalten Land...